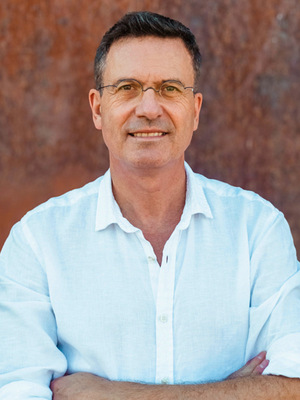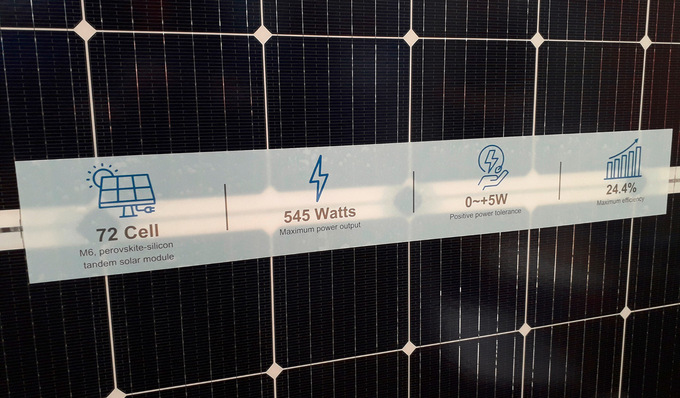2045 soll der Baubestand klimaneutral sein, doch mit der energetischen Sanierung und der Umstellung der Wärmebereitstellung auf erneuerbare Energien geht es nur schleppend voran. Als eine der Ursachen wird das sogenannte Mieter-Vermieter-Dilemma identifiziert. Gut die Hälfte des Wohnraums in Deutschland wird vermietet. Über eventuelle Modernisierungsmaßnahmen wird in der Regel über die Köpfe der Bewohnerinnen und Bewohner hinweg entschieden. Paragraf 555 d, Absatz 2, BGB verpflichtet sie, Modernisierungen zu dulden, sie können höchstens versuchen, gegen anschließende Mieterhöhungen rechtlich vorzugehen (die häufig von den Energieeinsparungen nicht kompensiert werden).
Den Vermietenden andererseits bieten sich aufgrund der begrenzten Umlagemöglichkeit – gedeckelt bei acht Prozent – keine echten Anreize, in die konsequente Dekarbonisierung zu investieren. Die Folge ist ein Modernisierungsstau, unter dem nicht zuletzt ebenfalls wieder Mieterinnen und Mieter zu leiden haben, leben sie in mangelhaft isolierten und dazu fossil beheizten Wohnungen, in denen es im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß ist, und deren Heizkosten tendenziell weiter steigen werden. Rapide noch einmal voraussichtlich ab 2028, wenn die Ausweitung des europäischen Emissionshandels (EU-ETS 2) auch auf den Gebäudebereich greift, was den CO2-Preis weiter nach oben treiben wird.
Mietende an der Planung beteiligen
Soll die Dekarbonisierung des Gebäudebestands vorankommen, muss sie gesellschaftlich akzeptiert sein. Dafür muss sie sozial gerecht gestaltet werden, unter Berücksichtigung der Interessen der Wohnungswirtschaft wie der der Mieterinnen und Mieter. Da ist es naheliegend, Letzere als die hauptsächlich Betroffenen in die Planung einzubeziehen und zur Partizipation einzuladen. So lautet die Grundidee mehrerer Forschungsprojekte.
Eines davon, Wärme4Alle [1], ist offiziell im November 2023 gestartet und läuft noch bis Oktober 2026. Ziel des Projektes ist es, mit übertragbaren Methoden und Vorgehensweisen eine Art Blaupause für partizipative Planungsprozesse in Wohnquartieren zu schaffen. Die Leitung hat das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung inne (Fraunhofer ISI) [2]. Zur rechtlichen Seite des Mieter-Vermieter-Dilemmas arbeitet ihm das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) [3] zu, ein An-Institut der Universität Greifswald. Um die Analyse der Eigentümerstrukturen sowie die Entwicklung der Quartierstypologien kümmert sich das Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung in Bochum (InWIS) [4].
Last, but not least ist da die EPC Projektgesellschaft für Klima Nachhaltigkeit Kommunikation, mit Sitz in Berlin und in Essen, zuständig für die Durchführung des Beteiligungsprozesses und für die Öffentlichkeitsarbeit. Der Gebäude-Energieberater sprach mit EPC-Projektmanagerin Svenja Klinz und dem geschäftsführenden Gesellschafter Ulich Eimer über die Anfänge, die Herausforderungen und die bisherigen Erkenntnisse und Ergebnisse des Projekts.
Drei repräsentative Quartiere ausgewählt
Zu den Herausforderungen zählt, das war schon im Vorhinein klar, das Managen der Kommunikation zwischen den Fachleuten auf der einen Seite, in den Wohnungsunternehmen, und den meist weniger fachkundigen Mieterinnen und Mietern auf der anderen. Diese Aufgabe ist umso anspruchsvoller, je heterogener letztere Gruppe ist. Entsprechend wählte man als Pilotquartiere solche mit sozialer Diversität. „Alle drei sind bewohnt von Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, Einkommen und Lebenssituationen“, erklärt Klinz.
Konkret handelt es sich um die Quartiere Staudengarten in Bochum, Durlach Aue in Karlsruhe und Gottlaßstraße/Hopfenbergstraße in Leipzig, in denen in den kommenden Jahren bauliche Modernisierungsmaßnamen anstehen und in denen es die kommunalen Wohnungsgesellschaften als Vermietende laut EPC ernst mit der sozial gerechten Dekarbonisierung ernst: in Bochum die VBW Bauen und Wohnen, in Karlsruhe die Volkswohnung und in Leipzig die LWB Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft. Die drei Wohnviertel stehen laut EPC exemplarisch für viele Bestandsquartiere in Deutschland und werden von Akteuren getragen, die einen Transformationswillen besitzen. Dazu gebe es eine Vielfalt an Gebäudetypen, vom Siedlungsbau der 1920er bis zur Zeilenbebauung der 1970er.
Infostände anstatt Workshops
Pläne macht man, um sie beizeiten anzupassen. Angedacht war ein Vorgehen in mehreren Schritten, wovon der erste jeweils das Einholen von Informationen über das jeweilige Quartier war. Sie dienten zur Vorbereitung von Starter-Workshops, Informationsveranstaltungen, zu denen auch per Brief eingeladen wurde und in denen das grundlegende Wissen vermittelt werden sollte, um an den Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Auf die Starter-Workshops sollten drei Zukunfts-Workshops folgen, in denen vom Fraunhofer ISI entwickelte Szenarien der Dekarbonisierung („Zukunftspfade“) vorgestellt und diskutiert werden sollten. Zwischen den Workshops sollten sich die Beteiligten digital mittels einer Beteiligungsplattform über die Szenarien austauschen und sie bewerten können.
In Bochum und Karlsruhe, wo die Projekte bereits weit fortgeschritten sind, machten die Beteiligten Klinz zufolge allerdings durchwachsene Erfahrungen mit den Einführungsveranstaltungen im Workshop-Format: „Obwohl sie direkt im Quartier stattfanden, blieben viele Plätze leer. Der zeitliche Aufwand, die formale Struktur und mitunter auch die Angst vor Fachsprache schreckten ab.“ Folglich wurde umdisponiert – und das mit Erfolg: „Deshalb haben wir Infostände ausprobiert. Diese führten zu einer wesentlich höheren Beteiligung. Viele haben spontan angehalten, Fragen gestellt oder einfach mal reingehört. So konnten wir auf Augenhöhe ins Gespräch kommen, erste Themen sammeln und Vertrauen aufbauen.“
Die digitale Kluft stellt eine Herausforderung dar
Parallel dazu entwickelt EPC die digitale Plattform weiter, denn es hat sich herausgestellt, dass manche der Bewohner:innen, eben keine Digital Natives, mit ihr nicht abgeholt werden. „Die digitale Beteiligung bleibt oft hinter den Erwartungen zurück, weil sie bestimmte Fähigkeiten und eine aktive Eigeninitiative voraussetzt“, erläutert Klinz. Dennoch sei sie ein wichtiges Werkzeug: „Sie ergänzt die Gespräche vor Ort und bietet allen Interessierten eine Möglichkeit, sich bequem von zuhause aus zu informieren und mitzumachen.“ Basis des Portals ist eine in Spanien entwickelte Open-Source-Software namens Decidim, die den partizipativen Meinungs- und Informationsaustausch ermöglicht.
Strategien gegen Desinformation entwickeln
Die vom Fraunhofer ISI konzipierten unterschiedlichen Szenarien der Modernisierung fanden auch ein unterschiedliches Echo: „Die größten Vorbehalte erleben wir immer dann, wenn Maßnahmen spürbar in den Wohnalltag eingreifen, zum Beispiel durch Fassadendämmungen oder umfangreiche Bauarbeiten. Solche Eingriffe sind verständlicherweise mit Sorgen verbunden.“ Mietende fürchte Lärm, Einschränkungen und mögliche Mietsteigerungen.
Hinzu kommt etwas, was viele Energieberatende aus ihrem Berufsalltag kennen: „Desinformation begegnet uns regelmäßig, insbesondere bei Themen, die emotional aufgeladen oder schwer verständlich sind. Viele Gespräche beginnen mit Missverständnissen oder falschen Annahmen, etwa der Sorge, dass bestimmte Heizungen verboten oder Mieten durch Sanierungen unbezahlbar würden. Solche Narrative kursieren vor allem über soziale Medien und prägen die öffentliche Wahrnehmung spürbar.“
Doch dem lässt sich entgegenwirken, wie Klinz erklärt: „In einem offenen, informellen Rahmen lassen sich viele Vorurteile abbauen.“ Man weise dann darauf hin, dass das Projekt technologieoffen arbeite, keine politischen Vorgaben durchsetze und die Interessen der Mietenden ernst nehme. „Wer sich ernst genommen fühlt, ist auch eher bereit, sich auf Neues einzulassen – eine wichtige Voraussetzung für eine sozialverträgliche Wärmewende im Quartier.“ Nicht vergessen dürfe man allerdings mögliche Sprachbarrieren.
Energieberatende können als vermittelnde Instanz mitwirken
Als Schlüssel zum Erfolg gilt die Niedrigschwelligkeit des Informationsangebots. Man müsse komplexe Inhalte so aufbereiten, „dass alle Beteiligten sie verstehen, einordnen und mitgestalten können.“ Auf Seiten der Wohnungsunternehmen sei das technische Wissen natürlich vorhanden, die hätten ihre Fachleute mit langjähriger Erfahrung in Planung und Umsetzung energetischer Maßnahmen. „Was allerdings häufig fehlt, ist eine Brücke zwischen dieser fachlichen Expertise und den Bedürfnissen der Mietenden“, resümiert Klinz.
Hier könnten Energieberater:innen künftig eine entscheidende Rolle übernehmen als vermittelnde Instanz, die technische Lösungen verständlich macht, Sorgen aufnimmt und Vertrauen aufbaut. Dafür braucht es neben der Fachkompetenz aber vor allem Kommunikationsstärke und soziale Sensibilität, aufsuchende Beratung direkt im Quartier, mehrsprachige Ansprache und die Fähigkeit, komplexe Inhalte klar und alltagsnah zu erklären.