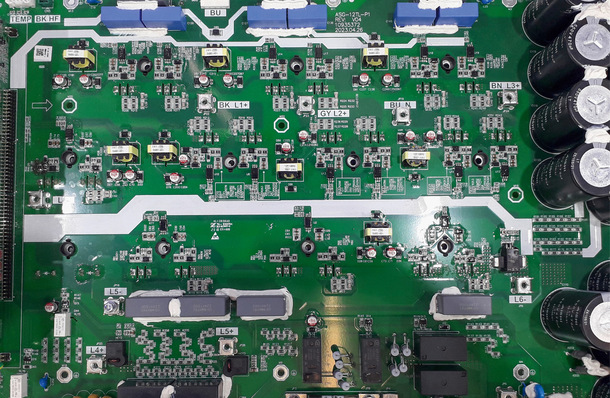Die Bundesregierung hat das Betriebskonzept der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV) als Alternative zum Mieterstrommodell eingeführt. Der Vorteil: Der Betreiber der PV-Anlage ist weitgehend von bürokratischen und unternehmerischen Pflichten befreit. Mittlerweile gibt es erste Best-Practice-Beispiele, die Mut machen und zum Nachahmen motivieren könnten – wenn sie denn bekannter wären. Eine allgemein zugängliche Übersicht von realisierten GGV-Projekten gibt es jedoch nicht. So werden an unterschiedlichen Orten von unterschiedlichen Akteuren mit viel Aufwand einzelne Umsetzungsvarianten erarbeitet.
Eigentümer und Stadtwerke lernen gemeinsam
David Scherwitz ließ im Dezember 2024 eine 27,8 Kilowatt-PV-Anlage auf dem Dach seines Wohngebäudes in Rheine in Nordrhein-Westfalen installieren - zunächst als Volleinspeiseanlage. Seit April 2025 betreibt er diese nach dem Konzept der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung. Der Datenmanager und ehrenamtliche Solarbotschafter des Kreises Steinfurts hat alle drei Wohneinheiten im Gebäude an die Stadt vermietet, die darin sozial bedürftige Bewohner unterbringt.
„Damit gibt es für die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung für mich nur einen Vertragspartner“, erklärt Scherwitz. „Außerdem hat die Stadt entschieden, dass die Stadtwerke Rheine die Reststromlieferung für alle Wohneinheiten und den Allgemeinstrom übernehmen. Wir haben hier also insgesamt eine sehr einfache Konstruktion. Das gibt Sicherheit, erleichtert die Kommunikation und macht das Projekt für die Stadt attraktiv. Sie wollte mit mir die Pionierarbeit machen. Jetzt lernen wir gemeinsam laufen.“
Im Gebäude gibt es einen PV-Zähler und vier Wohnungszähler, einen davon für den Allgemeinstrom. Im Gebäudestromnutzungsvertrag mit der Stadt hat der Anlagenbetreiber einen dynamischen Verteilschlüssel vereinbart. Der PV-Strom wird also zwischen allen Teilnehmenden im Verhältnis ihres Verbrauchs aufgeteilt. Die Stadt zahlt 80 Prozent des ortsüblichen Tarifs. „Das Problem ist nicht die Installation im Zählerschrank, sondern die Abrechnung“, meint Scherwitz. Doch der Anfang ist gemacht – die ersten Daten liegen ihm vor. Anhand der eingespeisten Strommenge kann Scherwitz seine Einspeisevergütung kontrollieren. Und mit den Verbrauchsdaten der Wohneinheiten kann er den von ihm gelieferten Strom gegenüber der Stadt abrechnen.
Warten auf die schlauen Zähler
Nahezu zeitgleich initiierte Karsten Liebmann in Halle ebenfalls ein GGV-Projekt. Der selbstnutzende Wohnungseigentümer ließ mit Zustimmung der übrigen Eigentümer eine 15-Kilowatt-Anlage auf dem Dach der Gemeinschaft errichten. Er ist alleiniger Eigentümer und trägt außer den Investitionskosten sämtliche Ausgaben für Betrieb, Erhaltung und Wartung. „Die Anlage war bereits im Januar betriebsbereit, da fehlten jedoch noch die Zähler. Deshalb haben wir sie zunächst allein für unsere Einheit genutzt und die Überschüsse eingespeist“, berichtet Liebmann.
Im März ersetzte der Stromnetzbetreiber Halle Netz die vorhandenen Messsysteme mit Zweirichtungszählern durch Smart Meter mit Gateway. Erst damit war die gesetzlich vorgeschriebene viertelstündliche Erfassung der Strombezugsmengen in den einzelnen Einheiten möglich. Das Betriebskonzept konnte auf die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung umgestellt werden. Fünf der sechs Wohneinheiten im Gebäude und eine Arztpraxis machen mit. Liebmanns eigene Wohneinheit ist Vorrangnutzer, die Verteilung auf die übrigen erfolgt nach einem dynamischen Schlüssel.
Scherwitz ist im Solarenergie-Förderverein aktiv. Liebmann ist Berater für Energie- und Prozessoptimierung. Beide sind solar-affin. Martin Erhardt hingegen ist gelernter Musiker – und ehrenamtliches Mitglied im Gemeindekirchenrat der evangelischen Johannesgemeinde in Halle. Er hat sich seit Ende 2023 in mühsamer Kleinarbeit in das GGV-Konzept eingearbeitet, unzählige Gespräche geführt, Erfahrung im Vergleich von Angeboten gesammelt und viel Überzeugungsarbeit geleistet.
Mit Erfolg: Auf dem Dach eines gemeindeeigenen Altbaus produziert seit Mitte 2025 eine 20-Kilowatt-PV-Anlage Strom. Im Haus befinden sich neben Gemeinderäumen, einer Kindertagesstätte und einem Archiv des Kirchenkreises vier große Mietwohnungen. Sechs der Einheiten bekommen nun Strom vom Dach. Die Mieter der siebten Einheit sind noch unentschlossen. In einem Batteriespeicher kann ein Teil des Eigenstroms zwischengespeichert werden. Der Rest gelangt ins öffentliche Netz.
GGV gehört zu Nachhaltigkeitskonzept
„Unsere Ausgangssituation war: Wir hatten eine sehr große zusammenhängende Dachfläche und einen sehr hohen Strombedarf im Gebäude, der sich dank der unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten gut über den Tag verteilt“, beschreibt Erhardt die Ausgangssituation für sein Projekt. Außerdem hatte die Gemeinde ein Nachhaltigkeitskonzept erstellt und die Landeskirche stellte Fördermittel bereit. All das sprach für die Idee, eine Solaranlage zu errichten und gemeinsam zu nutzen. Klar war: Der Betrieb wäre nur dann wirtschaftlich, wenn nicht nur die Gemeinde ihren Eigenbedarf deckte, sondern möglichst viele weitere Nutzer mitmachten.
Unterstützung in der Umsetzung fand die Kirchengemeinde bei einem lokalen Planungs- und Installationsbetrieb, der bereit war, sich auf die schwierigen Installationsbedingungen einzulassen. Am Dach waren teils Ausbesserungen nötig, denn die Ziegel waren mit Beton verschmiert. Zudem sollte die Anlage auf zwei Dachflächen verteilt werden, die durch einen Falz gegliedert sind. Andere Firmen wären allenfalls bereit gewesen, eine PV-Anlage auf dem mit Bitumen bedeckten Dach eines anderen Gemeindegebäudes zu installieren. Doch das wollten die Kirchengemeinde und ihr rühriger Projektinitiator nicht. Mit gutem Grund: Das Alternativdach besitzt eine Neigung von 28 Grad, das von ihnen bevorzugte Ziegeldach weist mit einer Neigung von 45 Grad nach Süden und verspricht damit auch im Winter ansehnliche Solarerträge.
Eine vermeintliche Hürde, der Denkmalstatus des Gebäudes, ließ sich vergleichsweise einfach meistern: „Ein Runderlass des Landes Sachsen-Anhalt, wonach eine Photovoltaikanlage auf denkmalgeschützten Gebäuden regelmäßig zu genehmigen ist, hat uns sehr geholfen. Auflage der Denkmalschutzbehörde war nur, dass die Fläche einheitlich gestaltet wird. Das haben wir durch farblich angepasst Blindbleche über den dreieckigen Dachfalzen erreicht“, erläutert Erhardt.
Mit den teilnehmenden Nutzern im Haus hat die Kirchengemeinde Gebäudestromnutzungsverträge mit einem dynamischen Verteilungsschlüssel abgeschlossen. Halle Netz hat neue Smart Meter eingebaut. Nun wartet Erhardt auf die ersten Daten zur Einspeisung und den Verbräuchen. „Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer im Gebäude künftig etwa 50 Prozent des Stroms von ihrem jeweiligen Versorger beziehen, im Sommer vielleicht nur dreißig“, lautet seine Prognose.
Netzbetreiber kämpfen mit der Digitalisierung
Dass die drei engagierten Einzelkämpfer ihre Projekte realisieren konnten, verdanken sie nicht zuletzt den beiden Messstellenbetreibern vor Ort. Die Stadtwerke Rheine und Halle gehören damit zu einer kleinen Minderheit unter den kommunalen Energieversorgern in Deutschland. Zwar sind nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft einzelne Großstädte offen für das GGV-Konzept, doch von Umsetzungen ist nichts bekannt. „In einzelnen Städten wie etwa in Halle sehen wir First Mover, die sich bemühen, ihren Kunden das Modell der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung nutzbar zu machen – beispielsweise, um ihr Portfolio zu erweitern oder auch weil das Smart-Meter-Rollout vor Ort schon weit fortgeschritten ist“, berichtet Tobias Otto vom Solarenergie-Förderverein Deutschland. Andernorts seien jedoch die Netzbetreiber, die oft zugleich grundzuständige Messstellenbetreiber sind, der Engpass. Einerseits stockt die Installation von Smart Metern, andererseits müssten in den IT-Systemen der Netzbetreiber die Voraussetzungen zur Datenverarbeitung noch geschaffen werden.
Eine Alternative können wettbewerbliche Anbieter sein, so die Einschätzung von Matthias Kühnbach, Professor für dezentrale Netze für regenerative Energien an der Hochschule Kempten und vormals Leiter der Forschungsgruppe „Datenbasierte Betriebsführung von Energiesystemen“ am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. „Startups und wettbewerblichen Messstellenbetreiber sind wesentlich agiler als die grundzuständigen Messstellenbetreiber“, sagt er. „Das liegt auch daran, dass sie die Messung, Erfassung und Verrechnung der Daten nicht in vorhandene Strukturen und Abläufe integrieren müssen.“
Eigentümer, die sich selbst um den Betrieb ihrer Photovoltaikanlage zur Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung kümmern wollen, können sich auf die Suche nach einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber machen. Eine Liste – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – gibt es beim Solarenergie-Förderverein.
Wer zudem den Aufwand des Betriebs und der Abrechnung scheut, ist mit einem Dienstleister gut bedient. Inzwischen lässt sich aus einem großen Angebot an meist jungen Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Geschäfts- und Preismodellen wählen. Sie übernehmen in der Regel den GGV-Betrieb - teilweise auch die Planung und den Bau der PV-Anlage - und arbeiten mit einem grundzuständigen oder wettbewerblichen Messstellenbetreiber zusammen. Er übernimmt den Einbau der intelligenten Messsysteme, liest die Daten aus und übermittelt sie an den Energieversorger. Einzelne wettbewerbliche Messstellenbetreiber treten selbst als Dienstleister auf.
Soziale Wohnungswirtschaft bekundet großes Interesse
Das Hannoveraner Unternehmen Marcley zeigt auf seiner Internetseite eine ganze Reihe von GGV-Referenzen. Wohngebäude sehr unterschiedlicher Größe und Eigentumsform sind dabei. Auf 13 Mehrfamilienhäusern sind bislang GGV-Anlagen ans Netz gegangen, mehr als 70 weitere stehen vor der Inbetriebnahme. Anfangs seien die Anfragen von allen Eigentumsformen gekommen, so die Beobachtung von Geschäftsführer Friedrich Grimm. Inzwischen habe sich die soziale Wohnungswirtschaft – also Wohngebäude von kommunalen Unternehmen, Genossenschaften und Kirchen – als Schwerpunkt herausgestellt. Im Mittel umfassten die Gebäude 40 bis 50 Wohneinheiten.
Der Energieversorger bietet den Kunden drei Geschäftsmodelle an. All-in-One: Er plant und baut eine PV-Anlage auf dem Dach des Kunden, trägt die Investitionskosten und wird Eigentümer. Sale-and-Lease-Back: Alternativ zahlen die Kunden die Investition in eine von Marcley errichtete Anlage, werden also Eigentümer. Die dritte Variante ist Leasing: Marcley pachtet eine vorhandene oder vom Eigentümer zu bauende PV-Anlage.
In allen drei Modellen fungiert Marcley als Anlagenbetreiber. Die Konditionen für den GGV-Betrieb sind jeweils gleich: „Für den auf dem Haus erzeugten Strom zahlen die teilnehmenden Haushalte brutto 22,99 Cent pro Kilowattstunde, garantiert für zehn Jahre“, erklärt Grimm. „Der monatliche Grundpreis beträgt brutto 1,99 Euro pro Wohneinheit. Für die Zähler-Umrüstung fallen keine Kosten an.“
Das Berliner Unternehmen Vrey hat nach eigenen Angaben bei rund 30 Projekten in zwölf Bundesländern Zähler für GGV-Projekte installiert, drei Anlagen seien bereits am Netz, hunderte weitere auf der Zielgeraden. „Circa 60 Prozent der Anfragen auf unserer Internetseite sind Wohnungseigentümergemeinschaften. Bei den 30 Projekten, für welche nur noch die erste Abrechnung aussteht, ist der WEG-Anteil allerdings deutlich geringer“, sagt Geschäftsführer Julius Pahmeier. Er ist jedoch überzeugt: „Das Konzept hebt gerade erst vom Boden ab.“
Auch der bislang auf Mieterstromlösungen spezialisierte Dienstleister Metergrid sieht in der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ein Geschäftsfeld. Er bietet Eigentümern zwei Leistungspakete an. Zentrale Bausteine sind die erforderliche Messtechnik und die Abrechnung. „Wir arbeiten mit wettbewerblichen Messstellenbetreibern zusammen. Sie übernehmen den Einbau der intelligenten Messsysteme und stellen uns die ausgelesenen Daten zur Verfügung. Die virtuelle Verrechnung zwischen Eigenstromerzeugung und den einzelnen Verbräuchen im Viertelstundentakt übernehmen wir. Diese Daten kommunizieren wir an den Eigentümer der PV-Anlage, damit er eine rechtskonforme Abrechnung mit seinen Mietern vornehmen kann“, erläutert Geschäftsführer Julian Schulz.
Für einen Kleinvermieter betreut das Unternehmen ein erstes GGV-Projekt, weitere sind in Vorbereitung. Standardisierte Prozess- und Kommunikationswege zwischen den Marktakteuren gibt es bislang nicht, so eine wesentliche Erkenntnis des Dienstleisters. Seine Konsequenz: Sehr früh das Gespräch mit allen Beteiligten suchen.
Branche gerät in Bewegung
Die Geschäftsmodelle der drei Unternehmen und damit auch ihre Preisgestaltungen lasen sich schwer vergleichen. Die Branche ist in Bewegung, neue Anbieter mit neuen Konzepten sind zu erwarten. Klar ist: Jeder Dienstleister, der den GGV-Betrieb übernimmt, will daran etwas verdienen. „Da sollte man genau hinschauen. Man bindet sich an einen Vertragspartner, von dem man nicht weiß, wie lange er auf dem Markt sein wird“, gibt PV-Experte Otto zu bedenken. Die wachsende Zahl an Referenzen der Firmen kann bei der Orientierung helfen. Zugleich motivieren die Best-Practice-Beispiele zum Nachahmen.
Das erlebt auch Solarbotschafter Scherwitz in Rheine. Dort wartet ein Eigentümer mit einer bereits installierten PV-Anlage auf seinem Vier-Parteienhaus auf die Klärung von letzten Abrechnungsdetails, um die Anlage als Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung betreiben zu können. Alle vier Wohneinheiten wollen mitmachen. Zwei von ihnen beziehen den Reststrom von den Stadtwerken, zwei von anderen Versorgern.
Bei diesem Projekt werden die Anforderungen an die Beteiligten also etwas höher als bei der Anlage auf dem Haus von David Scherwitz. Beide PV-Anlagen wurden vom selben Elektriker installiert. Der hat nun einen Auftrag im rund 20 Kilometer entfernten Schüttorf. Die Eigentümer habe Interesse an der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung und bei den dortigen Stadtwerken nachgefragt. Für sie ist das Konzept Neuland. Scherwitz wird sie beraten.

Bild: David Scherwitz

Bild: Smooth Energy/Jonas Knothe

Bild: Paul Petschel
GGV im Überblick
Ein Gebäudeeigentümer oder ein Dienstleister errichtet gebäudenah eine Photovoltaikanlage und leitet den Strom an die Verbraucher im Haus, ohne dass er durch das öffentliche Netz fließt. Er schließt mit den Bewohnern einen Gebäudestromnutzungsvertrag, der regelt, wie der Eigenstrom an sie verteilt wird und was sie zahlen. Die Verteilung erfolgt virtuell mit der Abrechnung.
Voraussetzung dafür ist, dass die Verbräuche der Einheiten mit intelligenten Messsystemen im Viertelstundentakt gemessen werden. Für die Reststromlieferung schließen die Verbraucher Verträge mit Versorgern ihrer Wahl. Der Betreiber der PV-Anlage hat damit nichts zu tun. Er ist zudem weitgehend von Informations- und Rechnungslegungspflichten befreit. Die Details egelt §42b des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).