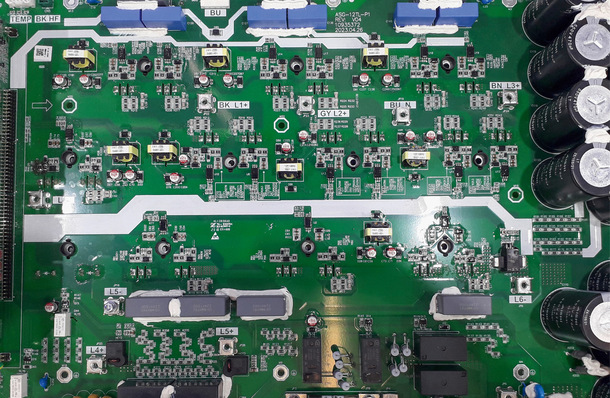Die Bauwirtschaft gehört zu den ressourcenintensivsten Wirtschaftssektoren. Entsprechend groß ist das Potenzial für die Kreislaufwirtschaft. Bestandsgebäude stellen Materiallager dar, die genutzt werden sollten. Materialien und Bauteile sollten daher erst gar nicht zu Abfall werden, sondern wiederverwendet werden. Abfälle, die sich nicht vermeiden lassen, sollten unter anderem durch Recycling im Wirtschaftskreislauf gehalten werden. So ist es in der Abfallhierarchie im Kreislaufwirtschaftsgesetz festgehalten. Das Gleiche fordert auch das Umweltbundesamt.
Nun könnte man denken, dass genügend Bauprodukte vorhanden sein sollten, die dem Kreislauf wieder zugeführt werden können. Doch Materialverfügbarkeit ist eine der größten Herausforderungen, berichtet Christine Lemaitre, geschäftsführende Vorständin der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Und dies hat mehrere Gründe. Ausbaumaterialien müssen genau in die Architektur des Neubaus passen. „Wenn man zum Beispiel für ein großes Gebäude 20 Türen benötigt, dann muss man zunächst mal auch 20 baugleiche oder zumindest ähnliche finden“, sagt Lemaitre.
Damit ist es allerdings nicht getan. Die potenziellen Re-Use-Materialien müssen auch zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sein – und am passenden Ort. „Zirkuläres Bauen ist ein sehr regionales Thema“, ergänzt Lemaitre. „Wenn man drei Ziegelsteine von München nach Hamburg fährt, um dort eine neue Fassade zu realisieren, dann muss man nicht erst eine Ökobilanz erstellen, um zu merken, dass da etwas nicht stimmt.“
Gegebenenfalls müssen Materialien zwischengelagert werden. Doch dafür benötigt man eine entsprechende Infrastruktur wie etwa Freiflächen und Hallen. Und so kann die Wiederverwendung in bestimmten Fällen nicht nur aufgrund der Ökobilanz, sondern auch aus finanzieller Sicht keinen Sinn mehr ergeben.
Regulatorik noch nicht angepasst
Hinzu kommt das Thema Haftung. Das Bauteil, das ausgebaut wurde, muss an seinem neuen Einsatzort sicher seine Funktion erfüllen. Bei einem Stahlträger beispielsweise muss gewährleistet sein, dass dieser die Tragkraft bietet, die im neuen Gebäude verlangt wird. Da stellt sich die Frage: Wer haftet bei einem Material, das wiederverwendet werden soll, im Unglücksfall? „In der Regulatorik befinden wir uns noch immer in einer Neubaudenke“, sagt Lemaitre. So kann es passieren, dass Material zunächst nicht genutzt werden kann, weil es als Abfall deklariert ist.
Verfügbarkeit, Regulatorik, Kosten – es sei nicht nur eine einzige Stellschraube, an der gedreht werden müsse, um das zirkuläre Bauen voranzubringen, sagt Lemaitre. Wie komplex die Thematik ist, zeigt etwa das Beispiel „Wilhelmsburger Rathausviertel“ in Hamburg. Auf dem Gelände der Internationalen Bauausstellung sollen circa 1.600 Wohneinheiten mit gewerblichen Nutzungen und ergänzender sozialer Infrastruktur auf einer Fläche von 32 Hektar entstehen. Es ist Teil des EU-Forschungsprojekts Circuit, in dem nachhaltige und zirkuläre Strategien für den Bausektor entwickelt werden.
Wenn der Kreislaufgedanke im Mittelpunkt steht
Eines der ersten Projekte, die im Wilhelmsburger Rathausviertel in die Umsetzung gehen, ist ein Gebäude auf einem Grundstück, das im Süden des zukünftigen Quartiers liegt. Es umfasst rund 185 Eigentumswohnungen und freifinanzierte sowie geförderte Mietwohnungen. Dabei handelt es sich um sogenannte Switch-Wohnungen – mit Grundrissen, die sich dem Alter und Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner anpassen lassen.
Konzipiert wurde das Gebäude von Behnisch Architekten. Auf dem internationalen Architekturforum der Messe Get Nord berichteten Angie Müller-Puch und Maria Hirnsperger, Partnerinnen bei Behnisch Architekten, von dem Projekt. Der Entwurf orientiert sich laut Hirnsperger an vorab definierten Parametern: So wurde zunächst geklärt, was an Gebäuden, Räumen und Technik wirklich zwingend notwendig war. Und alles, was gebaut wird, soll zunächst dahingehend überprüft werden, ob es aus wiederverwendeten Bauteilen erstellt werden kann. Wo dies nicht möglich ist, sollen recycelte Rohstoffe verwendet werden. Weitere Vorgabe: Die Gebäude sollen so gebaut werden, dass sie sich leicht reparieren und an künftige neue Anforderungen einfach anpassen lassen.
Mit ihrem Konzept stoßen die Projektverantwortlichen auf Herausforderungen, die das zirkuläre Bauen generell zu einer komplexen Angelegenheit machen. Dazu zählt die Logistik, die laut Hirnsperger ein entscheidender Aspekt bei solchen Projekten ist. Es muss geklärt werden, welche Materialien wann und wo benötigt werden und ob sie zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Da Letzteres nicht immer der Fall ist, geht es darum, Lagermöglichkeiten zu schaffen. Laut Hirnsperger wird gerade geprüft, ob dafür entsprechende Flächen vor Ort verfügbar sind. Grundsätzlich seien Einlagern und Transport aber große Kostenfaktoren, die auch mal dazu führen könnten, auf ein bestimmtes Material zu verzichten.
Auch die notwendigen Zulassungen treiben die Projektverantwortlichen um. Mit der Stadt Hamburg sind sie diesbezüglich in engem Austausch. Aber für jeden Fall muss einzeln geklärt werden, welche Prüfzeugnisse notwendig sind und wer die Gewährleistung übernimmt. Es gebe nicht die eine allgemeingültige Lösung, an der man sich orientieren könne, erläutert die Architektin.
Am Anfang stehen viele Fragen
„Man muss das zirkuläre Bauen von vornherein mitdenken – im gesamten Planungsprozess, über alle Phasen hinweg“, sagt Kollegin Müller-Puch. „Und das schon sehr früh.“ Ein Beispiel: Um die anvisierten 600 Quadratmeter zu erreichen, wäre man mit dem Gebäude ursprünglich über die Hochhausgrenze gekommen. „Doch dann hätten wir viele zirkuläre Baustoffe nicht einsetzen können“, berichtet Müller-Puch. Daher wurden die Pläne geändert und andere Möglichkeiten geprüft, um auf die geforderten Quadratmeter zu kommen.
Zudem wurden laut Müller-Puch bewusst Orte geschaffen, an denen man wiederverwendete Materialien einbauen kann. Beispiel dafür sind die freigestellten Fluchttreppenhäuser. Die dort verbauten Fenster dienen ausschließlich dem Schutz vor Wind und Wetter, sie müssen keine besonderen thermischen Anforderungen erfüllen. So können auch wiederverwendete Fenster genutzt werden, welche die Standards, die für den Wohnbereich gelten, nicht erfüllen würden.
Grundsätzlich mussten vorab sehr viele Fragen geklärt werden, um das Projekt auf Kurs Kreislaufwirtschaft zu halten. Müller-Puch nennt einige davon: „Welche Bauteile sind wichtig, um klimaneutral und zirkulär zu bauen? Wo steckt denn dieses ominöse CO₂? Wie recyclingfähig sind die verwendeten Bauteile? Wie können sie im nächsten Lebenszyklus wiederverwendet werden?“ Es gelte, viele verschiedene Faktoren gegeneinander abzuwägen, um zu den richtigen Lösungen zu kommen.

Bild: Behnisch Architekten/moka-studio
Plattform vermittelt Materialien
Es gibt Unternehmen, die dabei helfen wollen, einige Herausforderungen des zirkulären Bauens zu bewältigen. Dazu zählt zum Beispiel die Firma Concular. Sie baut Materialien zur Weiterverwendung aus und vermittelt diese an neue Interessenten. Was dies konkret heißt, erklärt Marketing-Managerin Franziska Stein. „Im idealen Fall werden wir ein halbes Jahr vorher informiert, dass ein Gebäude um- oder rückgebaut werden soll. Nach Sichtung der dazugehörigen Materialliste und entsprechender Unterlagen, wie etwa Schadstoffgutachten, gehen Mitarbeitende von uns in das Gebäude, um die Materialien zu identifizieren und zu prüfen. Dann werden diese so ausgebaut, dass sie wiederverwendet werden können.“
Im Online-Shop von Concular können Interessierte die Materialien mit den relevanten Informationen finden, schon bevor sie aus dem Gebäude ausgebaut sind. Was nicht sofort verkauft wird, landet in sogenannten Mining-Hubs, die Concular im gesamten Bundesgebiet verteilt hat. Rund 500 Bauprojekte haben im vergangenen Jahr laut Stein das Angebot von Concular genutzt. Etwa eine Million Materialien seien bisher allein über die Hubs gesammelt worden. Typische Materialien beziehungsweise Bauteile, die Concular verkauft, sind zum Beispiel Fassadenelemente, Stahlträger, Ziegel oder Systemtrennwände. Vor allem letztere eignen sich gut für die Wiederverwendung, weil sie häufig Standardmaße haben. „Je modularer ein Bauteil, desto größer ist der Re-Use-Faktor“,
sagt Stein.
Daten sind die Grundlage
Entscheidend für das Concular-Geschäftsmodell sind Daten. „Wir brauchen Informationen über die Bauteile“, erklärt Stein. „Wir müssen zum Beispiel wissen, von wann sie sind und am besten auch, von welchem Hersteller sie stammen.“ Eine entsprechende Dokumentation sei sehr wichtig.
Concular hat daher auch an der DIN SPEC 91484 mitgearbeitet, die dazu dient, die Potenziale von wiederverwendbaren Bauprodukten in Gebäuden zu erfassen. „Unser großer Wunsch ist es, dass diese Norm zum regulatorischen Standard wird und jedes Gebäude, das um- oder rückgebaut werden soll, danach geprüft wird“, sagt Stein. Dann wären verbindliche Informationen darüber verfügbar, was aus einem Gebäude wiederverwendet werden kann.
Laut Stein gibt Concular die reguläre Gewährleistung neuer Produkte auf alle Bauteile, die verkauft werden. Wer sich noch länger absichern wolle, könne bei großen Gebäudeversicherungs-Gesellschaften zusätzliche Versicherungen für das Produkt abschließen.
Bleibt die Frage, ob sich der Einsatz von wiederverwendeten Materialien auch finanziell lohnt – also, ob diese günstiger sind als Neuprodukte. Laut Stein gibt es einen Preisunterschied, der besonders am Beispiel Systemtrennwände deutlich wird: „Das ist unser Parade-Baumaterial, mit dem wir uns sehr gut auskennen. Wenn uns ein Kunde die Zahl der Trennwände sowie die entsprechenden Maße nennt, dann müssen wir noch nicht einmal vor Ort sein. Wir können einen solchen Auftrag also mit sehr geringem Personaleinsatz abwickeln.“ Die Kosteneinsparungen gegenüber dem Kauf von neuen Trennwänden können in einem solchen Fall laut Stein bis zu 30 Prozent betragen. Bei allen anderen Bauprodukten liegt Concular im Schnitt zehn Prozent unter dem Neupreis.
Immer ein Abwägungsprozess
Das Wilhelmsburger Rathausviertel zeigt jedoch, dass es nicht vornehmlich wirtschaftliche Gründe sind, die für das zirkuläre Bauen sprechen. Denn der Gesamtaufwand für entsprechende Projekte ist groß. In ihrem Vortrag auf dem Architekturforum nennen Angie Müller-Puch und Maria Hirnsperger keine konkreten Zahlen – schließlich ist das Projekt noch lange nicht abgeschlossen. Aber sie können schon jetzt sagen, dass es nicht günstiger, sondern eher teurer wird als ein vergleichbares Projekt.
Laut Hirnsperger waren Kostenfaktoren nicht das entscheidende Kriterium in diesem Projekt. Grundsätzlich gehöre zum zirkulären Bauen auch immer ein Abwägungsprozess des Bauherrn, der für sich klären muss, wie wichtig es ihm ist, jenseits von finanziellen Aspekten Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. „Zudem müsste man eigentlich einem solchen Projekt auch den CO₂-Preis eines nicht nachhaltigen Gebäudes gegenüberstellen“, fügt Müller-Puch hinzu.
Doch der Preis bleibt eine Hürde beim Thema Kreislaufwirtschaft. Das berichtet zum Beispiel Volker Thome, der die Abteilung Mineralische Werkstoffe und Baustoffrecycling am Fraunhofer-Institut für Bauphysik leitet. Er und sein Team arbeiten an verschiedenen Verfahren, um das Recycling von Baustoffen – insbesondere Beton – zu verbessern. Doch der Kostenfaktor steht der verstärkten Verwendung der entwickelten Baustoffe noch im Weg. „Die Primärrohstoffe wie Kies sind immer noch zu billig“, sagt Thome.
Das Gleiche gelte für den Müllexport. So lange dieser so günstig sei, habe es jedes Recycling-Verfahren schwer, sich auf dem Markt durchzusetzen. „Wir verlieren jedes Jahr 2.000 Tonnen Gipskartonplatten, die nach Tschechien exportiert werden
– wohlwissend, dass wir in ein paar Jahren einen Gipsmangel in Deutschland haben werden.“
Er fordert von der Politik, entsprechend zu handeln. „Es müsste eine Art Belohnungssystem geben für Aufbereitungsunternehmen. Das Recycling muss lohnenswerter werden.“ Außerdem muss es seiner Meinung nach in Ausschreibungen verpflichtend sein, einen bestimmten Anteil von Recycling-Material zu verlangen.
Immerhin: DGNB-Expertin Lemaitre glaubt, dass der Druck durch die sich verschärfende Rohstoffknappheit wachse, verstärkt auf Recycling und Re-Use zu setzen. Industrien wie zum Beispiel die Glasbranche würden verstärkt entsprechende Systeme aufbauen. Zusätzlich bräuchte es noch mehr Plattformen wie Concular – vor allem auf regionaler Ebene. Ihr Fazit: „Es kommt schon einiges in Gang, aber wenn wir schon weiter wären, ließe sich die Kreislaufwirtschaft noch deutlich wirtschaftlicher umsetzen.“

Bild: Thomas B. Jones
Urban Mining in der Unibibliothek
Wie ein Gebäude als Rohstoff- und Materiallager dienen kann, zeigt die Zentralbibliothek der Technischen Universität Dortmund. Das Gebäude aus dem Jahr 1976 soll bis 2029 durch einen Neubau ersetzt werden. Vorgabe des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW ist es, die im Bestand befindlichen Baustoffe auf Wiederverwertbarkeit und Weiterverwendung zu prüfen. Zu den Bauteilen, die wiederverwendet werden können, zählen Deckenelemente, Leuchten, Regale und Holzbänke, die bereits zu einem Großteil weitervermittelt wurden.
Besonders interessant sind die Kalksandsteinwände im Untergeschoss – bestehend aus 2DF-Formaten mit einer Dicke von 11,5 bis 20 Zentimetern. Kalksandsteinhersteller Cirkel hat geprüft, inwieweit sie sich als Recyclingmaterial für die eigene Produktion verwenden lassen. Dafür hat er Stichproben der Steine entnommen – in Form von Bohrkernen sowie mit und ohne Mörtel. Diese wurden dann auf die grundsätzliche Eignung geprüft, insbesondere auf Schadstoff- sowie Asbestfreiheit, organische Rückstände und Umweltverträglichkeit. „Erfreulicherweise handelte es sich in Dortmund um ziemlich reine Kalksandsteinwände“, berichtet Anke Warnck, Chemieingenieurin bei Cirkel.
Das Material zu gewinnen, war jedoch mit einer Herausforderung verbunden. Bis heute wird in der Regel lediglich nach mineralischem Bauschutt getrennt – Beton, Kalksandstein, Porenbeton und Ziegel landen also auf einem Haufen. Um die Reinheit des Materials sicherzustellen, musste es sortenrein getrennt werden. „Dieses Vorgehen ist bei vielen Recyclingunternehmen noch nicht etabliert, was den gesamten Prozess sehr zeit- und kostenintensiv macht“, erklärt Warnck. Bisher wurden mehrere hundert Tonnen Kalksandstein aus dem Gebäude geholt, die in Brechanlagen zerkleinert und zwischengelagert werden.

Bild: Brandrevier