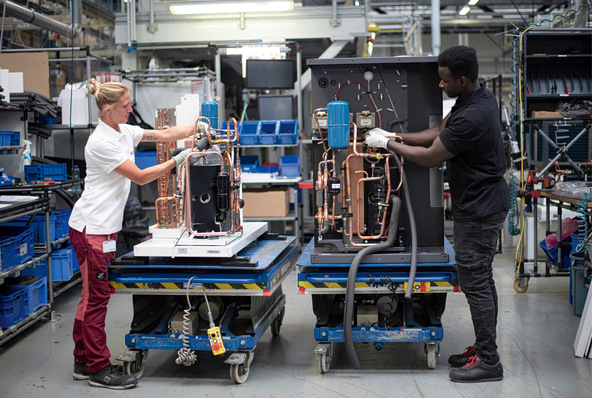Der Baustoff Lehm, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut, wird schon seit Jahrtausenden verwendet und ist in vielen historischen Gebäuden beziehungsweise historischen Bauteilen anzutreffen. Sein erster Einsatz ist in Deutschland bereits aus der Jungsteinzeit überliefert – so zum Beispiel in den Pfahlbausiedlungen am Bodensee, wo der Naturbaustoff als Putz für die Wände eingesetzt wurde. Dies setzte sich über alle Jahrhunderte fort. Im Mittelalter erreichte die Lehmbauweise ihren Höhepunkt, speziell bei Fachwerkgebäuden. Dort wurde Lehm im Wesentlichen als Material für die Ausfachung genutzt oder aber als Füllmaterial in den Decken, außerdem in Form von Stampflehmböden.
Steckbrief des Naturbaustoffs
Die Art und Weise, wie Lehm in der Vergangenheit genutzt wurde, erklärt sich aus seinen spezifischen Eigenschaften. Die muss man kennen, um ihn auch heute sinnvoll einsetzen zu können – ob im Innenausbau, in der Instandsetzung oder der Modernisierung. Lehm ist ein natürliches und ökologisches Material, das aus Ton, Schluff und Sand besteht. Für die Gewinnung aus Lehmgruben sowie für die Weiterverarbeitung ist kein hoher Energieeinsatz notwendig. Darüber hinaus ist Lehm nahezu unbegrenzt verfügbar und recycelbar.
Da es sich um ein Naturprodukt handelt, fallen die Kennwerte wie Rohdichte, Wärmeleitfähigkeit und Wasseraufnahmefähigkeit bei reinem Lehm stets etwas unterschiedlich aus. Die Rohdichte bewegt sich beispielsweise zwischen 1.600 und 2.000 kg/cm3, die Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,7 und 1,0 W/(mK). Lehm hat dadurch zunächst keine guten Wärmedämmeigenschaften, worauf noch gesondert eingegangen wird.
Eines seiner besonderen Merkmale ist seine hervorragende Fähigkeit zum Feuchteausgleich beziehungsweise seine ausgeprägte Sorptionsfähigkeit. Der Baustoff kann Wasserdampf aus der Luft aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben. Auch bei direkter Feuchtebeanspruchung kann er Wasser aufnehmen und langsam wieder abgeben. Gleichzeitig findet jedoch im Zuge der Veränderung des Wassergehalts eine Volumenänderung statt, abhängig vom Tonanteil.
Bei Lehmen mit einem hohen Tongehalt kann sich bei Wasseraufnahme das Volumen um bis zu zehn Prozent vergrößern. Wird das Wasser wieder entzogen, kann das Material dann entsprechend um bis zu zehn Prozent schwinden. Lehme mit einem hohen Anteil an feinen Tonpartikeln besitzen andererseits eine geringe Wasserdurchlässigkeit. Deswegen wurden sie in vorindustrieller Zeit gerne als Abdichtung von Fundamenten oder sonstigen erdberührenden Bauteilen ausgebildet oder als Fußböden von Erd- oder Untergeschossen, in Form von Stampflehm. Allerdings ist Lehm nicht wasserdicht, sondern kann unter andauernder Feuchtebeanspruchung aufweichen.
Bedingt durch seine Masse, dient Lehm auch als Wärmespeicher, hat gute Schallschutzeigenschaften, ist mit Diffusionswiderstandszahlen von 4 bis 12 relativ diffusionsoffen und zudem nicht brennbar. Der geringe Energieverbrauch bei der Gewinnung und Weiterverarbeitung verhelfen ihm zu einer sehr guten CO2-Bilanz – einer der Gründe, warum Lehm als Baustoff mittlerweile wieder gefragter ist.

Bild: Kleinewietfeld Architekten
Nicht zum Dämmen, sondern zum Abdichten genutzt
Immer wieder wird behauptet, dass Lehm in historischen Gebäuden als Wärmedämmung eingesetzt wurde. Das aber ist eine Fehlinterpretation. Oftmals wurden Holzkonstruktionen mit reinem Lehm oder Lehmgemischen verkleidet, verstrichen oder verputzt. Das im feuchten Zustand sehr plastische Material konnte hier gut verarbeitet werden. Bedingt durch die relativ hohe Wärmeleitfähigkeit, ergeben sich bei solchen Lehmauflagen jedoch keine signifikanten Reduzierungen des Wärmedurchgangs der Bauteile. Es ist daher davon auszugehen, dass das Material im historischen Kontext zunächst nur zur Abdichtung verwendet wurde. Es wurden lediglich die Luft- und die Winddichtigkeit der Hüllflächen optimiert, weniger diente Lehm der Verbesserung des eigentlichen Wärmeschutzes.
Oftmals findet man bei Baudenkmälern noch sogenannte Balken-Bohlen-Decken, also eine engmaschige Verlegung von Deckenbalken mit dazwischen liegenden Bohlen, die auf der Oberseite mit einer Lehmauflage versehen sind. Die wurde in erster Linie dafür eingesetzt, die Konstruktion gegen Zugluft abzudichten. Die Dämmung erfolgte durch die recht massiv ausgebildeten Hölzer, die eine weit niedrigere Wärmeleitfähigkeit als Lehm aufweisen.
Auch bei Bohlenwänden, die aus relativ massiven Holzbohlen errichtet wurden, erfolgte diese Überformung mit Lehm weniger zum Zweck der Wärmedämmung. Er sollte stattdessen ebenfalls die Luft- und die Winddichtigkeit verbessern und gegebenenfalls durch seine Masse ein gewisses Wärmespeichervermögen gewährleisten. Um den Verbund zwischen Lehm und Holz sicherzustellen, wurden Holznägel in die Bohlen eingebracht. Außerdem wurde das Material an solchen Stellen in geringem Maße mit Pflanzenfasern, Stroh und Tierhaaren versetzt, um es zu bewehren und damit unempfindlicher gegen Rissbildung zu machen.
Verbesserung des Dämmvermögens
Durch Kombination mit anderen Baustoffen kann Lehm in seinen Eigenschaften also modifiziert werden. Man kann zum Beispiel ebenso seine Rohdichte verringern, Porenräume schaffen und damit für eine Verbesserung des Wärmedämmvermögens sorgen. Regelmäßig anzutreffen sind in historischen Gebäuden sogenannte Lehmwickeldecken oder Stakendecken. Diese Konstruktionen bestehen aus in Nuten in den Deckenbalken eingeschobenen Staken, flachen Spalthölzern, in manchen Regionen auch „Stickscheite“ genannt, die mit einem mäßig wärmedämmenden Stroh-Lehm-Gemisch umwickelt wurden. Hierdurch konnte der Platz zwischen den Deckenbalken in der Regel über die gesamte Balkenhöhe gefüllt werden. Die Plastizität des feuchten Lehms erlaubte es, das Material lückenlos in Hohlräume und Fugen einzubringen. Die Wärmeleitfähigkeit von Strohlehm, die natürlich vom Strohanteil abhängig ist, wird in der Literatur mit Werten von um die 0,4 W/(mK) angegeben, was deutlich geringer ist als der Wert von reinem Lehm.

Bild: Kleinewietfeld Architekten
Gefachfüllung mit „Mindestwärmeschutz“
Die Lastableitung und die Aussteifung von Wänden erfolgt bei Fachwerkkonstruktionen ausschließlich über das Holz-Traggerüst. Die Gefache, also die Felder zwischen den Hölzern, haben keine statische Relevanz. Daher herrschte eine gewisse Wahlfreiheit, was die Gefachfüllung anging. In historischen Gebäuden wurden diese Felder auf unterschiedliche Art und Weise geschlossen. Beispielsweise erfolgte, gerade bei stärker bewitterten Wandflächen, eine reine Ausmauerung mit Natursteinen oder gebrannten Ziegeln. Sehr häufig wurden die Gefache allerdings mit Holzstaken oder Flechtwerken versehen und die Hohlräume dann mit Lehm oder einem Strohlehmgemisch verfüllt, um ein Mindestmaß an Wärmeschutz zu erhalten. Der Lehm sorgte dabei wieder für die Luftdichtheit der Hülle.
Wärmedämmeigenschaften entstanden erst durch die Strohanteile sowie durch das Flechtwerk oder die Staken beziehungsweise beides. Um Auswaschungen zu verhindern, wurden die Wandflächen außen in der Regel mit Kalkputzen überformt. Auch die Innenseiten wurden üblicherweise mit einem Putz versehen. Diese Konstruktionsweise, in der sehr oft auch Innenwände errichtet wurden, trifft man bis heute in vielen Baudenkmälern an. Zur Füllung der Gefache wurden in der Vergangenheit aber genauso getrocknete Lehmsteine verwendet und diese mit Lehmmörtel vermauert. Auch sie erhielten ihre wärmeisolierenden Eigenschaften erst durch die leichten, porigen Zuschläge im Ausgangsmaterial, beispielsweise aus gehäckseltem Stroh.
Ideal für das Bauen im (historischen) Bestand
Das Bauen im Bestand stellt uns in vielen Fällen vor die Herausforderung schadstoffbelasteter Bauteile und Materialien. Gerade Dichtstoffe oder Spachtelmassen müssen oft aufwändig zurückgebaut und entsorgt werden. Auch bei Baudenkmälern ist man nicht grundsätzlich sicher vor solchen Risiken, da viele historische Gebäude in der jüngeren Vergangenheit modernisiert, umgebaut oder erweitert wurden. Im Regelfall finden wir jedoch in historischen Häusern die traditionellen Baustoffe und Konstruktionsweisen.
Bei historischen Lehmbaustoffen besteht der große Vorteil, dass diese problemlos weiterverwendet und Fehlstellen ergänzt werden können. Ist ein Rückbau notwendig, stellt die Wiederverwendung oder im ungünstigsten Fall die Entsorgung kein Problem dar. Idealerweise kann man historische Konstruktionsarten allerdings in ihrer überlieferten Art ergänzen und mit den gleichen Materialien und Baustoffkombinationen vervollständigen, beispielsweise bei Lehmstakungen in den Decken. Diese Art der Reparatur ist besonders ressourcenschonend und wirkt sich extrem positiv auf die Gesamtenergiebilanz der Instandsetzung aus.

Bild: Klaus-Jürgen Edelhäuser
Auswirkungen auf das Raumklima
Für ein behagliches Raumklima ist neben der Temperatur die relative Raumluftfeuchte von großer Bedeutung. In vielen Wohnräumen ist die Luft – abhängig vom Nutzerverhalten – entweder zu feucht oder zu trocken. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit ergibt sich die allgemein bekannte Gefahr der Schimmelbildung, die letztendlich auch ein gesundheitliches Risiko darstellen kann. Doch auch zu trockene Raumluft beeinträchtigt nicht nur die Behaglichkeit, sondern kann sich ebenso gesundheitsschädlich auswirken. Die Beschwerden reichen von Austrocknung und Reizung der Schleimhäute bis hin zu Augenbeschwerden. Das Austrocknen vor allem der Atemwege macht anfälliger für Infektionen. Eine im Normalbereich eingependelte Luftfeuchte ist also essenziell für die Wohngesundheit.
Bereits eingangs wurde das hohe Sorptionsvermögen von Lehm erwähnt. Dank ihm können etwa Lehmputze beziehungsweise generell Oberflächen mit Lehmanteil helfen, ein gutes, gesundes Raumklima zu schaffen. Bei einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit wird ein Teil der Wassermoleküle vom Lehm aufgenommen, ein zu hoher Anstieg der relativen Raumluftfeuchte dadurch verhindert. Sinkt die Luftfeuchtigkeit, ist der Baustoff bestrebt, wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Die aufgenommene Feuchte wird an die Raumluft abgegeben. Gerade in Räumen mit regelmäßig starken Feuchteschwankungen, zum Beispiel in der Küche oder auch im Bad, kann dieser Effekt sehr hilfreich sein.
Diffusion und kapillarer Feuchtetransport
Behaglichkeit und Wohngesundheit gibt es nicht ohne einigermaßen warme Wandoberflächen. Moderne Lehmbaustoffe mit entsprechenden Zuschlagstoffen sind hierfür gut geeignet. Sie sind üblicherweise mit Blähton, Holzhackschnitzeln, Kieselgur, expandiertem Kork oder gehäckseltem Stroh durchsetzt. Gerade im historischen Bestand und hier vorzugsweise bei Fachwerkkonstruktionen werden diese Mischungen oder Baustoffe als Innendämmung eingesetzt.
Die Diffusionsoffenheit des Lehms und der bei Innendämmungen so wichtige kapillare Feuchtetransport werden durch entsprechende Zuschlagstoffe in der Regel noch verbessert. Welches Produkt in welcher Dicke eingesetzt werden kann, ist im Einzelfall immer zu prüfen und rechnerisch nachzuweisen. Jedenfalls bietet die Verwendung einer Innendämmung auf Lehmbasis eine ideale Kombination aus Wärmeschutz und Feuchteregulierung des Raumklimas.
Denkmalinstandsetzung ist eine kulturelle Aufgabe
Lehm ist damit ein in mehrfacher Hinsicht nachhaltiger Baustoff. Erstens ist eine Verknappung nicht absehbar, da er quasi überall ansteht, zweitens verursachen weder Abbau noch Aufbereitung noch Rückbau nennenswerte Treibhausgasemissionen oder sonstige Umweltbelastungen. Außerdem kann der Rückbau im Grunde gleich in die Wiederverwertung übergehen. Drittens kann Lehm die Raumluftqualität und das Innenraumklima verbessern und mit den passenden Materialien kombiniert den Wärmeschutz. Damit fördert er Behaglichkeit und Wohngesundheit, Faktoren, die ebenfalls zu den Nachhaltigkeitskriterien zählen. Zwar wird er wegen dieser Qualitäten auch im Neubau eingesetzt, doch sein wichtigstes Einsatzfeld wird die Instandsetzung von Baudenkmälern bleiben. Das ist nicht zuletzt aus kultureller oder volkskundlicher Perspektive eine wichtige Aufgabe.

Bild: Klaus-Jürgen Edelhäuser

Bild: Klaus-Jürgen Edelhäuser

Bild: Klaus-Jürgen Edelhäuser
Normen und Regeln für den Baustoff Lehm
Nachdem die Normen für den Lehmbau 1971 mangels Interesse eingezogen worden waren, gibt es seit 2013 wieder neue, die die Qualität einiger der vielen unterschiedlichen Baustoffe regulieren (https://t1p.de/GEB241040):
Was die nicht genormten und auf der Baustelle hergestellten Lehmbaustoffe betrifft, verweist der Dachverband Lehm auf die 2009 veröffentlichten Lehmbau-Regeln (https://t1p.de/GEB241041).