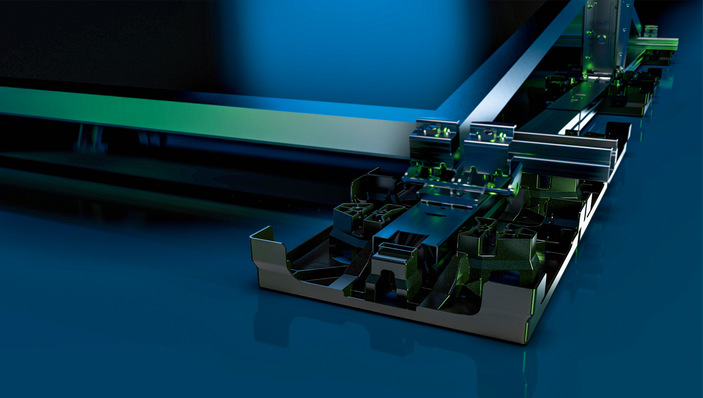Die durchschnittliche Haltbarkeit von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) wird in der Regel mit 40 bis 60 Jahren angegeben. Dabei wird allerdings meist nicht spezifiziert, welchen Bedingungen sie ausgesetzt oder wie sie aufgebaut sind. Im Kleingedruckten werden außerdem fachgerechte Planung und Ausführung sowie regelmäßige Wartung und Instandhaltung vorausgesetzt. Während jedoch die fachgerechte Planung in den meisten Fällen sichergestellt ist, geschehen im Zuge der Ausführung nicht selten gravierende Fehler, die zu technischen Schäden führen können. Inspektionen oder gar Wartungen stellen zudem eine absolute Ausnahme dar, sodass Wärmedämm-Verbundsysteme immer öfter instandgesetzt werden müssen. Dieser Beitrag setzt sich mit den unterschiedlichen WDVS sowie den typischen Schäden auseinander, bevor im zweiten Teil die verschiedenen Methoden und Verfahren der Instandsetzung vorgestellt werden.
Die Anfänge und die erste Generation
Wärmedämm-Verbundsysteme gibt es seit Ende der 1960er Jahre. Legt man die Absatzzahlen nach den verfügbaren Quellen [1] zugrunde, wurden bisher 1,452 Milliarden Quadratmeter an die Außenwände geklebt und gedübelt. Dies würde etwa einem Viertel der Fassadenfläche in Deutschland entsprechen. Da aber im Laufe der mittlerweile langen WDVS-Geschichte an manchen Fassaden die Außendämmungen entweder rückgebaut und durch neue ersetzt oder im Rahmen einer Aufdopplung überdämmt wurden, kann man von den abgesetzten Quadratmetern, soweit statistisch erfasst, nur ungefähr auf die tatsächlich heute landesweit mit WDVS versehenen Außenwandflächen schließen.
Ein Blick in die technische Entwicklung dieser besonderen Form der Außendämmung zeigt, wie sie allmählich optimiert wurde, aber auch, wie heterogen die „historisch gewachsene“ Fassadendämmung im deutschen Gebäudebestand deswegen gegenwärtig ist. Nach den Anfängen in den späten 1960ern kann man etwa ab den beginnenden 1970er Jahren von der ersten Generation von WDVS sprechen. Sie prägte den Markt bis zum Ende der 1980er. Hauptsächlich bestanden diese Kombinationen aus expandiertem Polystyrol (EPS) als Dämmstoff, dem Unterputz samt Armierung und einem Kunstharzputz als Schlussbeschichtung. Später wurde das erste nicht brennbare, mineralische System entwickelt, bestehend aus Mineralwollplatten und einem mineralischen Putzaufbau, 1977 erstmals erhältlich. In dieser Phase ging es vor allem darum, den „Vollwärmeschutz“, wie man das Wärmedämm-Verbundsystem damals nannte, als neues Bausystem für die Außendämmung zu etablieren.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass erst mit der Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung im Jahr 1977 überhaupt einmal bauaufsichtliche Regelungen für WDVS vorgelegt wurden – zu diesem Zeitpunkt waren bereits 67 Millionen Quadratmeter Fassadenfläche mit diesem neuartigen Außenwärmeschutz ausgerüstet worden. So wundert es nicht, dass in den frühen Jahren auch fehlerhafte Systeme an die Wände kamen. Insbesondere Feuchtigkeitsprobleme durch stark diffusionshemmende Putze, die zu Blasenbildung führten, sowie Durchfeuchtungen an Bauteilanschlüssen kennzeichnen die Anfangsphase, auch das Schüsseln der Dämmplatten. Einige bekannte Hersteller nahmen daraufhin ihre entsprechenden Produkte wieder aus dem Sortiment.
Im besagten Zeitraum wurden die Systeme auf 218,3 Millionen Quadratmetern verlegt, die heute 35 bis 55 Jahre alt wären oder sind und mit großer Wahrscheinlichkeit in der Zwischenzeit mehrfach renoviert, saniert und eventuell auch modernisiert oder rückgebaut und erneuert wurden. Sie erfüllen die heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz nicht, insbesondere da die Dämmstoffdicken der ersten Generation noch bei lediglich 20 bis 50 Millimeter lagen.
Die nächste Generation: neue Materialien
Ab den 1990er Jahren kam die zweite Generation von WDVS auf den Markt und beherrschte ihn bis Ende der 2000er. Diese Phase war geprägt durch technisch verbesserte und optimierte Systeme. Neue Dämmstoffe tauchten auf, neben Mineralschaum- und Phenolharz- auch Hartschaumplatten aus Polyurethan. Zudem müssen Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen genannt werden, wie Hanf, Kork, Schilf.
Hinzu kamen neue Befestigungen, zum Beispiel Thermodübel (mit verminderter Wärmebrückenwirkung) und Klebeanker sowie weitere Materialien zur Oberflächengestaltung (Klinker, Naturstein, Riemchen). Erste Systeme mit bioziden Zusätzen für die Schlussbeschichtung wurden Ende der 1990er Jahre eingeführt und Anfang der 2000er Jahre kamen erste funktionale Oberflächen auf (etwa eine Beschichtung mit Lotus-Effekt).
Außerdem nahm die Dämmstoffdicke zu, auf jetzt 60 bis 100 Millimeter, und die Wärmeleitfähigkeit verbesserte sich auf Werte zwischen 0,035 und 0,042 W/mK.
In diesem Zeitraum wurden WDVS auf 733,3 Millionen Quadratmetern verlegt, die heute 15 bis 35 Jahre alt sind und in der Regel mindestens einmal renoviert oder saniert wurden. Die überwiegende Mehrheit dieser Systeme erfüllt die heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz ebenfalls nicht. Allerdings ist eine Modernisierung häufig aus ökonomischen Gründen nicht zu rechtfertigen, sodass die meisten dieser Dämmungen weiterhin unverändert an den Fassaden verbleiben. Diese Fläche entspricht der Hälfte der nach den Branchen-Statistiken mit WDVS gedämmten Fassaden im Gebäudebestand und stellt das interessanteste Marktpotenzial dar.
Ab 2010: dritte Generation mit zahlreichen Neuerungen
Für die dritte Generation von WDVS, ab 2010 verbaut, ist eine intensive technische Optimierung charakteristisch. Durch teilweise unsachliche Berichterstattung in den Medien waren die Anbieter gezwungen, Vorurteilen entgegenzuwirken und neue Lösungen bereitzustellen: die ersten biozidfreien Systeme kamen auf den Markt. Das Wärmedämmvermögen der Hartschaumplatten wurde weiter erhöht, beispielsweise durch Zugabe von Graphit zum EPS oder zum Polyurethan (PU), was dem Material eine charakteristische neue Färbung gab, zwischen Grau und Schwarz.
Auch am Brandschutz wurde weitergearbeitet, beispiels-
weise durch Einführung des Brandriegels. Erstmals waren zudem extra schmale WDVS mit einem Wärmeleitwert von 0,022 W/mK zu bekommen. Perforierte Dämmplatten sollten eine bessere Wasserdampfdiffusion sicherstellen und eine besondere TSR-Beschichtung (engl. Total Solar Reflectance) sollte Fassaden mit dunklen Farbtönen ermöglichen, die sich auch unter direkter Sonneneinstrahlung nicht zu stark aufheizen.
Nun setzten sich die Hersteller auch mit dem Thema Kreislaufwirtschaft auseinander, boten die ersten recyclingfähigen Systeme an, deren Komponenten beim Rückbau zu trennen sind. Außerdem nahm die Dämmstoffdicke in den 2010er Jahren zunächst auf 100 bis 150 Millimeter zu, und liegt heute bei durchschnittlich 150 bis 200 Millimetern. Entsprechend verringerte sich die Wärmeleitfähigkeit auf Werte zwischen 0,036 und 0,023 W/mK. Seit 2010 wurden Stand 2024 Systeme auf 501,1 Millionen Quadratmetern aufgebracht, die weitestgehend die heutigen Wärmeschutzanforderungen erfüllen und in der Zwischenzeit höchstens einen Renovierungsanstrich erhalten haben.
Mögliche Schadensursachen und Schadensbilder
Aus dieser kurzen Typologie der WDVS-Generationen sollte klar geworden sein, dass vor der Instandsetzung ein genaues Hinsehen erforderlich ist. Die technischen Schäden, um deren Beseitigung es in erster Linie gehen soll, sind hauptsächlich auf
Zwar wird im zweiten Teil dieses Artikels auch auf die rechtlichen Aspekte eingegangen, etwa auf die Gewährleistungsansprüche, die sich im Kontext der Erneuerungen ergeben. Die Gewährleistung nach dem erstmaligen Aufbringen jedoch – innerhalb der fünf Jahre nach BGB beziehungsweise für Architekt:innen innerhalb der zehn Jahre nach Abnahme – wird ausgeklammert, da „historische“ WDVS im Vordergrund stehen. (Sie waren bereits Gegenstand von Untersuchungen des Fraunhofer IBP [2].)
Die oben genannten Ursachen können zu folgenden Schäden und Mängeln an Wärmedämm-Verbundsystemen führen:
Einige dieser Schäden stellen „nur“ optische Beeinträchtigungen dar, andere können sich unmittelbar auf die Funktion eines WDVS auswirken und/oder die Haltbarkeit deutlich reduzieren; vermeintlich harmlose Schäden können weitere verursachen. Deshalb muss bei der Instandsetzung von Wärmedämm-Verbundsystemen unterschieden werden zwischen
Daraus ergibt sich in der Regel, ob eine Instandsetzung kurzfristig erfolgen muss oder mittelfristig erfolgen kann. Die technischen Grundlagen liefert die DIN 55699:2017-08 „Anwendung und Verarbeitung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) mit Dämmstoffen aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder Mineralwolle (MW)“, mit der erstmals die Überarbeitung geregelt ist. Außerdem wird auf einschlägige Empfehlungen verwiesen [3].
Viel zu tun
Da der Begriff der „Überarbeitung“ recht unpräzise ist, wird im zweiten Teil zwischen Renovierung, Sanierung und Modernisierung unterschieden. Eine Renovierung dient ausschließlich der optischen Verbesserung der Fassade, wie etwa der Renovierungsanstrich bei Algen- und/oder Pilzbefall. Die aktuellen Anforderungen des Wärmeschutzes werden dabei nicht eingehalten. Ebenso wenig bei der Sanierung, bei der Schäden wie beispielswiese Risse beseitigt werden.
Ziel einer Modernisierung ist dagegen ein zeitgemäßer Wärmeschutz. Hierzu gehören zum Beispiel die Aufdopplung, aber auch der Rück- und der komplette Neuaufbau eines Systems. Man kann grob davon ausgehen, dass derzeit circa 150 Millionen Quadratmeter bestehender WDVS auf eine Instandsetzung warten.

![Totalschaden: Ursache war ein fehlender Haftverbund eines ausschließlich geklebten und nicht gedübelten WDVS. - © Bild: aus [4] Totalschaden: Ursache war ein fehlender Haftverbund eines ausschließlich geklebten und nicht gedübelten WDVS.](/sites/default/files/styles/teaser_image_full__s/public/aurora/2025/10/484139.jpeg?itok=VQUIHJQs)

![Marktentwicklung verlegter WDVS-Flächen [in Mio. m²] - © Bild: Autor Marktentwicklung verlegter WDVS-Flächen [in Mio. m²]](/sites/default/files/styles/image_gallery__s/public/aurora/2025/10/484140.jpeg?itok=Gwh12ba6)
![Schadensbild aus den Anfängen der WDVS: Diffusionsprobleme im Systemaufbau in Kombination mit dem Schüsseln von Dämmplatten - © Bild: aus [4] Schadensbild aus den Anfängen der WDVS: Diffusionsprobleme im Systemaufbau in Kombination mit dem Schüsseln von Dämmplatten](/sites/default/files/styles/image_gallery__s/public/aurora/2025/10/484141.jpeg?itok=8cQ2btG-)
![Algen- und Pilzbefall, der durch Dübelabzeichnungen besonders auffällig ist. Die Wärmebrückenwirkung der Dübel sorgt für geringere Feuchte. - © Bild: Sto/aus [4] Algen- und Pilzbefall, der durch Dübelabzeichnungen besonders auffällig ist. Die Wärmebrückenwirkung der Dübel sorgt für geringere Feuchte.](/sites/default/files/styles/image_gallery__s/public/aurora/2025/10/484142.jpeg?itok=OIctQMjo)
![Rissbildung an Bauteilanschlüssen, hier an einer Fensterbank: Der Putz war zu dünn aufgetragen worden. - © Bild: aus [4] Rissbildung an Bauteilanschlüssen, hier an einer Fensterbank: Der Putz war zu dünn aufgetragen worden.](/sites/default/files/styles/image_gallery__s/public/aurora/2025/10/484143.jpeg?itok=VWSHB2FG)