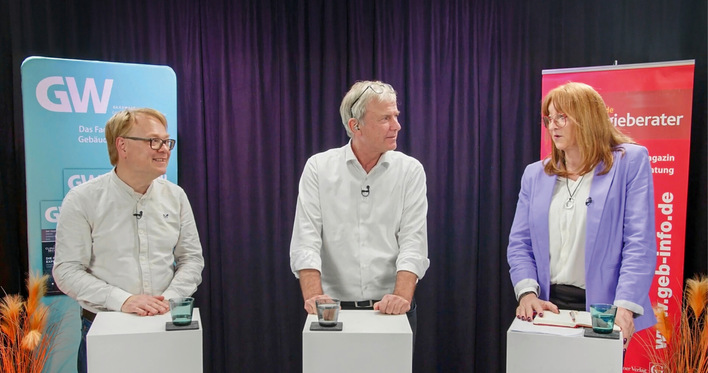Während seiner ISH-Pressekonferenz hatte Bosch Thermotechnik-Geschäftsführer Jan Brockmann ein griffiges Bild gewählt, um das Engagement des Heizungskonzerns zu beschreiben: „Wir reden über die Dekarbonisierung bis 2045 und bauen eine breite Auffahrt für die Autobahn dahin.“ Es sollen also zügig die Voraussetzungen für eine rasche Wende in deutschen Heizungskellern geschaffen werden. Das Problem: Nicht nur Brockmann denkt vornehmlich an die Wärmepumpentechnologie.
So wie es derzeit läuft, werden nicht alle erneuerbaren Energien die Auffahrt nutzen können. Für Biomasseheizungen hat die Bundesregierung einige Stolpersteine in der Förderung eingebaut. Sie muss sich, um im Bilde zu bleiben, durch enge Kreisverkehre und kleine Dorfstraßen schlängeln, ohne zu wissen, ob sie nicht früher oder später in einer Einbahnstraße landet. Und für die kleine Solarthermie hat der Gesetzgeber einen Fahrradweg vorgesehen, auf dem sich nur langsam vorankommen lässt.
Derweil plant die Heizungsindustrie hohe Investitionen in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten für Wärmepumpen. Das zeigt, was und wie schnell es möglich ist, wenn die Politik klare Ziele ausgibt. So will Bosch Thermotechnik, wie das Unternehmen bei der ISH bekanntgab, in den kommenden zwei Jahren 700 Millionen Euro für den Wärmepumpenhochlauf ausgeben. Viessmann hat bereits im vergangenen Jahr verkündet, die Rekordsumme von einer Milliarde Euro in grüne Klimalösungen zu stecken. Und die Vaillant Group plant bis 2030 Investitionen von zwei Milliarden Euro.
Das Geld haben die Unternehmen in den vergangenen Jahren verdient. Seit 2017 folgte ein Rekordjahr dem nächsten – selbst während der Pandemiezeit. Im vergangenen Jahr hat Bosch Thermotechnik einen Rekordumsatz von 4,5 Milliarden Euro erzielt und im deutschen Wärmepumpengeschäft um 75 Prozent zugelegt. Viessmann konnte seinen Gesamtumsatz um 19 Prozent auf insgesamt vier Milliarden Euro steigern. Mit einem Plus von 60 Prozent hat der Wärmepumpenverkauf einen großen Teil dazu beigetragen.
Solarthermie und Holzpellets bleiben unberücksichtigt
Angesichts dieser Entwicklung können Firmen, die sich auf erneuerbare Energien spezialisiert haben, nur neidisch zusehen. Im Fall der Solarthermie lässt sich sogar von einem Niedergang einer Industrie sprechen. Einige deutsche Kollektorhersteller haben ihre Produktion in den vergangenen Jahren beendet, unter anderem Vaillant. Zu Hochzeiten vor über zehn Jahren waren Maschinenbaufirmen eingestiegen und hatten moderne automatische Produktionsmaschinen für die Kollektorfertigung entwickelt. Sie hatten damit den Boden für eine Massenfertigung bereitet. Die meisten der Firmen haben diesen Geschäftsbereich inzwischen eingestellt und mussten ihre Investitionen abschreiben. Was fehlte, war die Unterstützung aus Politik und Handwerk.
Dabei wäre die Solarthermie jetzt mehr vonnöten denn je. Ohne sie wird die Wärmewende nicht gelingen – gerade, weil alles auf eine Elektrifizierung der Wärmeversorgung hinausläuft. Das funktioniert aber nur nachhaltig, wenn es sich bei der Elektrizität um Ökostrom handelt. Davon wird in Deutschland zwar immer mehr produziert, doch auch der Bedarf steigt. Nicht nur wegen der Wärmepumpen – auch Elektroautos sollten mit Ökostrom fahren und die Industrie damit ihre Maschinen betreiben. „Ökostrom ist zu kostbar, um ihn in Wärme zu verwandeln. Es ist eigentlich Verschwendung, wenn man diese Wärme mit Solarthermie effektiver erzeugen kann“, schreibt Herausgeber Detlef Koenemann richtigerweise im Editorial des neuen Solarthermie-Jahrbuchs.
Pelletkesselherstellern könnte Ähnliches bevorstehen wie den Kollektorproduzenten. Die deutliche Kürzung der Zuschüsse hat die Antragszahlen einbrechen lassen. In den ersten beiden Monaten gingen lediglich 246 beziehungsweise 321 Anträge auf Förderung einer Biomasseheizung beim Bafa ein. Hinzu kommt die unsäglich undifferenzierte, weil pauschal negative Bewertung der Holzheizungstechnologien.
Die aktuelle Politik bestätigt ein Gutachten, das das Bundeswirtschaftsministerium beim Beratungsunternehmen Prognos in Auftrag gegeben hat. Laut dem Hintergrundpapier zur Gebäudestrategie Klimaneutralität 2045 werden Wärmepumpen zum zentralen Wärmeerzeuger. Biomasse dagegen dürfe im Gebäudebestand nur in stark begrenzten Mengen eingesetzt werden. Für den Neubau werde sie zukünftig keine Rolle spielen. Bezüglich der Solarthermie schreiben sie von einer Nischentechnologie. Ihre Rolle bleibe untergeordnet. Stattdessen wird die Photovoltaik angepriesen. Technologieoffenheit sieht anders aus. Potenziale werden verschenkt.
Fossile bleiben in Hybridanlagen erhalten
Wie schnell sich die Prioritäten ändern können und sich die Heizungsindustrie angesichts neuer politischer Weichenstellungen umstellen kann, zeigten die vergangenen beiden ISH-Fachmessen. So thematisierten die Branchengrößen vor zwei Jahren, pandemiebedingt virtuell, vor allem den Einsatz von Wasserstoff als umweltfreundliche Lösung für die Zukunft und priesen Gas-Brennwertkessel, die H2-ready seien. In diesem Jahr standen hauptsächlich neue Wärmepumpen prominent aufgestellt auf ihren Messeständen.
Was nicht eine vollständige Abkehr von den fossilen Brennstoffen bedeutet. Mit Blick auf den besonders hohen Anteil von unrenovierten Altbauten geht nicht nur Bosch Thermotechnik davon aus, dass bei etwa zwei Dritteln der Gebäude teils erhebliche Sanierungskosten für einen effizienten Wärmepumpenbetrieb nötig sind. Der Konzern setzt deshalb auf Hybridanlagen, die aus einer Wärmepumpe und einem ergänzenden Brennwertkessel für Spitzenlasten bestehen. Wärmepumpen könnten in diesen Systemen kleiner und damit günstiger dimensioniert werden.
Die Wärmewende sähe dann folgendermaßen aus: Wärmepumpen könnten zwar über eine breitere Auffahrt auf die Schnellstraße fahren, doch bliebe ihnen nur eine Spur zum Gasgeben, denn die Überholspur bliebe durch die Brennwertkessel blockiert.