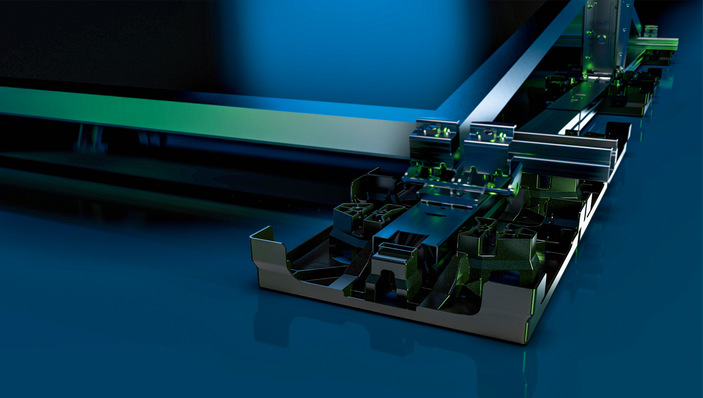Der Angriff der Administration des US-Präsidenten Donald Trump auf den Offshore-Windpark Revolution Wind mit 704 Megawatt (MW) geplanter Nennleistung ist in der globalen Erneuerbare-Energien-Geschichte wohl einmalig. Und doch wird er genau dies im wörtlichen Sinn leider wohl zunächst nicht bleiben: einmalig. Denn die Regierung in Washington kündigt nun bereits für weitere drei schon genehmigte Offshore-Windpark-Projekte vernichtende Schläge an.
Einmalig ist der Angriff bislang, weil vielleicht noch nie vorher ein so weit schon gebautes Windkraft-Riesenprojekt zugleich mit so noch nie dagewesenem Desinteresse an der Datenlage zu Auswirkungen und Nutzen eines Windkraftprojekts verhindert werden sollte. Und weil diese US-Regierung danach offenbar nicht einmal den Versuch unternehmen will, einen neuen ihr genehmen Rechtszustand zu erreichen, an den sich die Investoren von Revolution Wind und anderer Offshore-Windparks in den USA mit Änderungen am Projekt vielleicht noch anpassen könnten.
Trump-Regierung stoppt US-Offshore-Park mitten im Bau
Wie Unternehmen der Meereswindkraft in den USA reagieren
The Good, the Bad and the Ugly: Zoll-Deal mit Trump

Fotografin: Nicole Weinhold
Wie seit der einstweiligen Baustoppverfügung am 23. August aus den bisherigen Disputen zwischen projektfeindlichen Regierungsbehörden und auf Seiten von Revolution Wind stehenden Akteuren klar wird, stützt sich die Regierung vor allem auf vage Verunglimpfungen des Windparks. Dieser sei ein Risikofaktor für die militärische Sicherheit und zugleich seien Nachweise für seinen Nutzen intransparent beziehungsweise nicht vorhanden. So sollen die Revolution-Wind-Unterwasserfundamente die Armee-Radare beim Überwachen von Tauchangriffen stören. Und selbst wenn der Windpark das Aufspüren eventueller U-Boot-Angriffe nicht ernsthaft stören sollte, würden doch Drohnenschwarm-Attacken durch ihn hindurch einen Vorteil gewinnen. Außerdem sei die Wirtschaftlichkeit der Windkraft grundsätzlich nicht gesichert, lautet ein als Expertise beigefügter Einwand seitens der nationalen Umweltschutzbehörde EPA. Und unter dem windkraftfreundlichen Vorgängerpräsidenten Joseph Biden hätten die nationalen Regierungsbehörden eine vollständige Überprüfung des Projektes als eigentlich notwendige Voraussetzung für dessen Genehmigung unterlassen.
Tatsächlich hatte das Projekt vor dem Baustart eine mehr als neunjährige Überprüfungsphase hinter sich gebracht. Der vorübergehende Baustopperlass nimmt dagegen nicht einmal Bezug auf die zuvor von den nationalen Behörden festgehaltenen Fakten, die für die Genehmigung sprachen und die sich auch ausdrücklich auf Interessen der militärischen nationalen Sicherheit und auf andere wirtschaftliche Nutzungsinteressen der See bezogen. Zudem geht der verfügte Baustopp über die Präsidentenverfügung Trumps von seinem ersten Amtstag hinaus, der solche Baustopps nicht für schon genehmigte und im Bau befindliche Projekte wie Revolution Wind vorsah. Zur Erinnerung: Zum Zeitpunkt der Baustopp-Order waren sogar schon alle Fundamente und 70 Prozent der Offshore-Turbinen errichtet.
Dass es nun außerdem bei dieser einmaligen Attacke auf fertige Offshore-Projektierungen nicht bleibt, entzieht ironischerweise Revolution Wind die zweifelhafte Position der Einmaligkeit und macht zugleich die Attacke insgesamt in ihrer Intensität erneut einmalig. So kündigte das Innenministerium der Trumpregierung schon am 27. August an, auch das genehmigte Zwei-Gigawatt-Vorhaben Maryland Offshore mit einer Verfügung zu stoppen. Und nachdem eine Behörde am 1. September angekündigte hatte, zugunsten des Offshore-Windpark-Ausbau vorgesehene zwölf Hafenerweiterungen anders als zugesagt nun doch nicht mehr zu fördern, folgte am 5. September die Baustoppankündigung für noch zwei Offshore-Windparks: New England Wind und South Coast Wind mit 791 MW in einer ersten Ausbaustufe und 1,3 Gigawatt (GW). Dass hinter diesen beiden Projekten wie bei Revolution Wind ebenfalls europäische Unternehmen als führende Akteure stehen – sowohl bei der Projektierung als auch der Finanzierung –, macht das Problem auch aus unserer deutschen Perspektive noch gewichtiger. Zumal in allen drei Fällen die Projektierungsunternehmen auch in deutschen Windkraft-Vorhaben aktiv sind: Bei Revolution Wind sind es als in deutschen Gewässern Mitprojektierende der dänische Energieversorger Ørsted und indirekt dessen Projektpartner Skyborn Renewables, hervorgegangen aus der ehemaligen Offshore-Windkraft-Sparte des Bremer Planungsunternehmens WPD. Bei New England Wind und South Coast Wind sind es in dieser Reihenfolge Iberdrola mit der US-Tochter Avangrid und im Joint-Venture-Verbund Ocean Winds aus Portugal EDP und aus Frankreich Engie. Während bekanntlich Iberdrola in der Ostsee projektiert, haben EDP und Engie als Windpark-an-Land-Planer oder als Meereswindstrom-Abnehmer wichtige Rollen im deutschen Markt. Auch beim Zwei-Gigawatt-Projekt Maryland Offshore ist zudem indirekt noch das italienische Windenergie-Unternehmen Renexia eingebunden.
Ørsted dürfte richtig darin handeln, wie das Unternehmen nun schon öffentlich erklärt hat: Streng nach rechtlichen Kriterien argumentierend, die zahlreichen Formfehler und die Willkürlichkeit der Trumpschen Administration offenbarend – so sieht offenbar die Strategie nun aus.
Möglicherweise kann dieses Vorgehen sogar schon Erfolge erzielen. Zumindest lassen die bisherigen Erfahrungen mit der US-amerikanischen Justiz im Umgang mit anderen willkürlichen Akten Donald Trumps auch in anderen politischen oder gesetzgeberischen Handlungsfeldern darauf hoffen. Denn immer wieder hat sich die Justiz gerade bei zu groben rechtlichen Verstößen der Regierung als widerständig gezeigt, die Regierung hie und da auch zum Einlenken gezwungen.
Schwieriger ist da die politische Reaktion der Gouverneure der betroffenen Bundesstaaten, die in allen diesen jüngeren Fällen die Offshore-Windprojekte im Gegensatz zur Regierung unterstützen. In der Regel sind sie auch direkt betroffen, weil die wichtigsten Energieversorger dieser Bundesstaaten bereits langfristige Stromabnahmeverträge abgeschlossen oder die Bundesstaaten selbst dies vorab ausgehandelt haben. Die Gouverneure argumentieren gemäß den bisher verzeichneten Reaktionen damit, dass die Windparks den Strompreis senken, Strom sogar billig machen, dass die US-Wirtschaft langfristig Arbeitsplätze durch die Windkraft gewinnen kann, dass die Offshore-Projekte die Energiesicherheit stärken.
Der eigentümliche Politikertyp Trump aber zeigt der Windenergiebranche und den sie unterstützenden Politikern ganz nebenbei auch auf, dass diese sich in einer bequemen grundsätzlich staatstragenden Haltung offenbar zu lange zu sicher gefühlt hatten. Immer wieder gerne haben Windkraftakteure und ihre Unterstützer gerade politische vorgesprochene Leitlinien als ihre eigenen Eigenschaften aufgegriffen, die sie gut oben mitschwimmen lassen und ihrer Sache doch nicht nachhaltig nutzen. Oder die nicht einmal zu ihr passen. Militärische und Versorgungssicherheit, Billigstrom, Arbeitsplätze – sie sind keine Ziele, mit denen eine Windkraftversorgung sich nicht gut versöhnen kann. Doch sind es beileibe auch keine Güter, die nicht auch komplett ohne Windkraft auskommen. Anders ist es da mit den Windkraftzielen der eigentlichen Energiewende wie Klimaschutz und insbesondere die Abkehr von der Nutzung fossiler Energierohstoffe in großen Kraftwerken, die nur wenigen gehören.
Warum das wichtig ist? Trump zeigt in seiner demonstrativen Willkürlichkeit, dass er Energie in seinem Land auch durch hemmungsloses Öl- und Gasfördern, zudem mittels zweifelhafter Fracking-Technologien und internationaler Zwangsmaßnahmen wie aberwitzig hohe Handelszölle billig, verfügbar und womöglich sogar kurzfristig krisensicher machen kann.
Wäre dies ein Kommentar nur über Trump, wäre er nun schnell fertig, wenngleich nutzlos. Trump, so bliebe noch zu sagen, ist immer wieder stark darin, anderen den Spiegel vorzuhalten. Er macht deutlich, dass manche zuletzt allzu siegessicher von der Erneuerbarenwelt und ihren politischen Verbündeten übernommene leichtfertige Rechtfertigung gegenüber der Öffentlichkeit nicht ganz echt war. Trump macht sich nicht einmal Mühe zu überzeugen: Bizarr überzeichnet übernimmt er die Argumente seiner Gegner für sich selbst mit freien Erfindungen: Die Streichung der Förderungen für den Offshore-Windkraft-bezogenen Hafenausbau begründet er beispielsweise damit, dass das Geld lieber in echte Hafeninfrastruktur gesteckt werden müsse: Zum Schiffebauen beispielsweise oder zu Verladung von fossilen Rohstoffen. Nicht für Spielzeug wie Windkraft, soll das heißen. Solche Rhetorik missachtet natürlich, was in der Wirtschaft zukunftsfähig ist. Doch seine noch verbleibenden wenngleich weniger werdenden Fans sind wohl begeistert.
Europäischer Union (EU) und den überwiegend zur EU gehörenden europäischen Windenergiestaaten – und auch den europäischen Branchenvertretern wäre vermutlich vor wenigen Jahren der Widerstand gegen diese Willkür noch leichter gefallen. Zugegeben bleibt nicht zu vergessen, dass sie auch schon infolge von Regierungswechseln in ihren eigenen Ländern einiges an Leid schon gewohnt sind.
Doch der Widerstand fällt auch deshalb schwer, weil die Akteure in Europa selbst schon viele von Trump nun vorgelebte Anti-Energiewende-Kapriolen vorgetanzt haben. Nicht zu vergessen ist der von Schweden schon 2024 vollzogene Stopp aus militärischen Gründen für fast alle Offshore-Windpark-Projekte in der Ostsee. Das nachträgliche und erfolgreiche Quasiverbot für die Bestellung chinesischer Windturbinen in Deutschland und Großbritannien und vielleicht bald auch Italien und Schweden. Sie waren ja erfolgt, nachdem sich Investoren aufgrund zu langer Lieferzeiten schon entschieden hatten oder die chinesischen Zulieferfirmen den Aufbau von Fabriken zugesagt hatten. Auch die plötzliche Einstufung der Atomkraft oder von LNG-Gas als nachhaltige Investments durch die EU dürfte der europäischen Erneuerbaren-Branche aufgrund nachlassender Nachfrage der Industrie an dann nicht mehr alternativlosem Grünstrom auf die Füße fallen.
Problematisch sind Maßnahmen gegen beispielsweise chinesische Dumping-Zulieferer nicht deshalb, weil sie sinnlos wären. Sie sind es vermutlich nicht. Aber die rückwirkende und nicht rechtssichere, klar aufgeschriebene Definition, was Standard ist, verunsichert die Märkte und hemmt technologische Entwicklung. Dies muss hier nicht weiter begründet werden, ist es doch eine branchenübliche Forderung, dass Technologie- und Marktentwicklung langfristig angelegte Zielsetzungen der Energiewende und ebenso langfristig wirksame Rahmenbedingungen erfordern. Und dann darf und muss die Politik dennoch beständig Stellschrauben nachdrehen oder qualitative Änderungen vornehmen um Fehlentwicklungen zu verhindern. Allerdings darf das nie rückwirkend geschehen und ohne Vorwarnung, weil sonst Lieferketten zusammenbrechen, Investoren zögern, Technologieentwickler keinen Mut aufbringen.
Trumps Argumente zeigen im Gegenteil den Unsinn kurzfristiger Maßnahmen auf. Ein letztes Beispiel? Die Offshore-Windparks gefährdeten auch deshalb die Sicherheit der USA, hieß es jüngst aus Washington, weil sie ausländische Bauteile nutzten. Klingt nach Anti-China-Dumpingmaßnahme, ist aber hier offenbar willkürlich gegen alles Windkrafttechnik der meist aus Europa gelieferten Anlagen gemünzt.
Einfach ist der Ausweg aus dem US-Strudel für die Offshore-Windkraft also nicht. Aber wo freiwilliges wie unfreiwilliges Anpassen an politische Großwetterlagen hinführt, durften jetzt Zuhörende bei einer Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erfahren. Die deutsche Politikerin hatte 2019 bei ihrem Amtsantritt den Green Deal der EU ausgerufen – als klare Energiewende-Wirtschaftspolitik. Diesen hat sie zwar nicht widerrufen, ihn aber neuen politischen Strömungen mit im EU-Parlament erstarkten konservativen und rechtspopulistischen Parteien als Clean Industrial Deal angepasst.
In ihrer Regierungsrede „zur Lage der (Europäischen) Union 2025“, protokolliert mit immerhin 7.680 Worten, kommt erneuerbare Energien nur in zwei Halbsätzen vor. Einmal nur indirekt mit dem Ziel, den Strom billig zu machen: „Und wir wissen, wie wir die Preise senken können: mit sauberer Energie aus heimischen Quellen“, sagte sie. Und definierte dies im Folgeteil – aber dann auch noch mit der neuen EU-weit geeinigten Einschränkung: „Wir müssen selbst mehr erneuerbare Energie erzeugen – mit Kernenergie für die Grundlast.“
Was das mit Trump zu tun hat? Vielleicht nichts, aber man weiß es halt auch nicht so genau, ebenso wenig, was sie mit Trump in dem von ihr kürzlich ausgehandelten EU-USA-Deal über die Energiewirtschaft und Handelszölle zu erneuerbaren Energien besprochen hat.


![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)