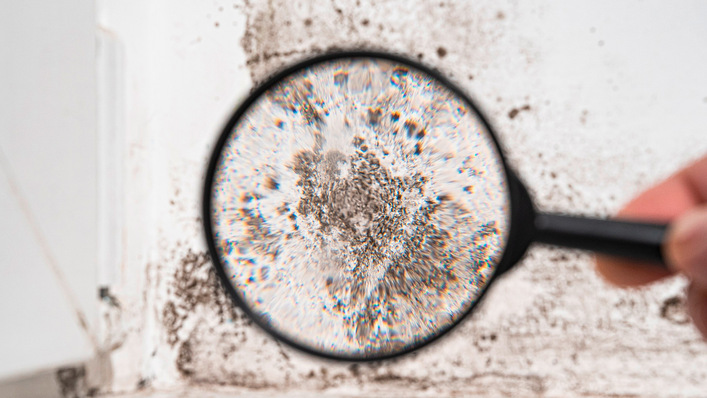Das Flächenpotenzial für die Agri-PV, also die Doppelnutzung von Flächen für Nahrungsmittel- und Stromproduktion, liegt in Deutschland bei 500 Gigawatt. Dies hat eine aktuelle Studie ergeben, die die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) erstellt haben. Allein dies würde das im EEG festgelegte Ausbauziel von 400 Gigawatt für das Jahr 2040 übersteigen. Dazu würde noch das Flächenpotenzial auf Dächern, an Fassaden und auf Konversionsarealen kommen.
Alle Landwirtschaftsflächen betrachtet
Für die Studie haben die Wissenschaftler erstmals alle Arten von Landwirtschaftsflächen einbezogen. Dazu gehören neben Dauergrünland und Ackerflächen auch Flächen, auf denen Dauerkulturen wie Obst, Wein oder Beeren angebaut werden, wie Studienautorin Salome Hauger erklärt. Auf der Basis von geographischen Informationssystemen hat ihr Team die Flächendaten nach zwei Kriterienkatalogen bewertet. In einem mehrstufigen Verfahren wurden danach die optimalen Standorte identifiziert.
Zwei Szenarien durchgerechnet
Im Kriterienkatalog haben die Forscher geografische Faktoren sowie rechtliche und behördliche Anforderungen berücksichtigt. Dadurch umfassen die Ergebnisse das regulatorische und technisch mögliche Potenzial der Agri-PV in Deutschland. Der Kriterienkatalog unterscheidet dabei zwei Szenarien. Im ersten haben die Forscher Flächen ausgeschlossen, die wegen harter Restriktionen für die Agri-PV nicht zur Verfügung stehen. Dazu gehören unter anderem Naturschutzgebiete. Im zweiten Szenario haben sie Flächen verworfen, die harten und weichen Restriktionen unterliegen wie Flora-Fauna-Schutzgebiete. Damit ist dieses Szenario das naturschutzfreundlichere.
SPE fordert mehr Engagement für Agri-PV in Brüssel
Die Ergebnisse sprechen für sich. So ergeben sich in der Potenzialanalyse für das erste Szenario 7.900 Gigawatt und für das zweite Szenario immer noch 5.600 Gigawatt installierbare Photovoltaikleistung. Dies ist ein Vielfaches, das Deutschland benötigt, um im Jahr 2045 klimaneutral zu werden.
Landwirtschaftliche Belange berücksichtigt
Dieses Potenzial haben die Forscher danach noch einmal hinsichtlich politisch-wirtschaftlicher und agrarökonomischer Kriterien ausgesiebt, um besonders geeignete Standorte zu finden. Hier spielten unter anderem die Sonneneinstrahlung und der mögliche Zugang zum Stromnetz als Kriterien eine besondere Rolle. Es wurden aber auch Flächen einbezogen, auf denen Pflanzen wachsen, die besonders von der Agri-PV profitieren. Dazu gehören Dauerkulturen wie Wein oder Obst.
Agri-PV: Äpfel reifen gut unter Solarmodulen
Flächen je nach Eignung aufgeteilt
Im dritten Schritt haben Experten aus Landwirtschaft, Wissenschaft, von Verteilnetzbetreibern und Solarprojektierern die einzelnen Kriterien noch einmal gewichtet. Daraus ergab sich ein Bodeneignungsindex, der die Flächen in fünf Eignungsklassen einteilt. „Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist die Rolle des Netzausbaus: Das Fehlen von Netzanschlusspunkten ist für viele Flächen ein einschränkender Faktor“, weiß Salome Hauger.
Doppelnutzung von Flächen: Unser Spezial zur Agri-PV zum Download
Auf diese Weise kommen die 500 Gigawatt an Potenzial heraus, die für die Agri-PV regulatorisch, wirtschaftlich, naturschutzrechtlich und agrarökonomisch sehr einfach möglich sind. „Diese Studien liefern eine solide Datengrundlage für politische Entscheidungsträger und Interessengruppen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern und zur Erreichung der Klimaziele beizutragen“, fasst Anna Heimsath, Abteilungsleiterin Analyse Module und Kraftwerke am Fraunhofer ISE, zusammen. (su)