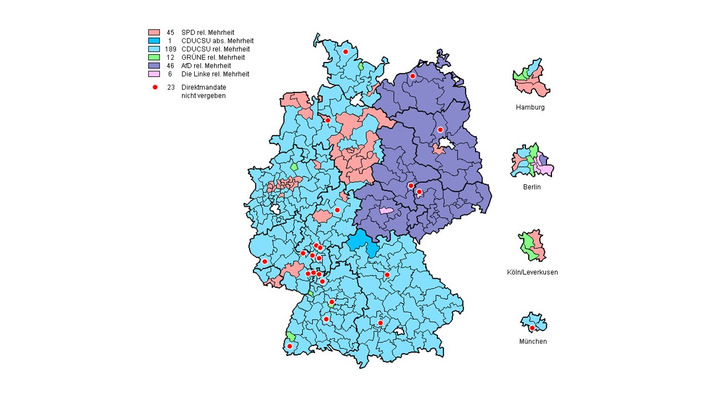Viele Geschäfte und Onlineshops steigern ihre Kundenbindung durch Bonussysteme. Wer die jeweilige Kundenkarte oder App nutzt, erhöht mit jedem Einkauf das Guthaben, welches später von der Rechnung abgezogen wird. Da gewerbliche Abnehmer gegenüber Privatkunden häufig höhere Umsätze generieren, kommt auch bei vielen Energieberatern rasch eine ansehnliche Summe zusammen – jedoch kann das Vermischen von privater und gewerblicher Nutzung steuerlich problematisch sein.
Bonusprogramme unterscheiden nicht, ob sie beruflich oder privat genutzt wird. Typische Beispiele sind das Betanken von Firmenautosfahrzeugen sowie der Genuss dieser Boni für Reise- und Übernachtungskosten, da mit der Bonuskarte dienstliche und private Reisen abgerechnet beziehungsweise Punkte gesammelt werden. Nicht selten werden verschiedene Karten für ein Konto benutzt, sodass sowohl der Energieberater als auch seine Angehörigen beim gleichen Anbieter Ansprüche erwerben. Payback und Deutschland Card werden häufig für Einkäufe im lokalen Handel genutzt, andere Programme wie Miles & More der Lufthansa haben weitere Anbieter integriert. Lebensmitteldiscounter setzen auf eigene Lösungen.
Ob sich der zeitliche und administrative Aufwand lohnt, lässt sich leicht abschätzen, wenn ein, zwei oder fünf Prozent der jeweiligen Kosten durch die Nutzung eines Bonusprogrammes angesetzt werden. Schlussendlich ist das jedoch eine Frage der Einstellung und Mentalität des Energieberaters.
Bonuskarten und professionelle Angebote
Bonuskarten sind primär für private Nutzer konzipiert. Bei höheren Umsätzen haben die Anbieter spezielle Programme für Unternehmer im Angebot. So lohnt es sich bei einem einzelnen Fahrzeug, die übliche Bonuskarte zu nutzen, wenn man es betankt. Bei mehreren Fahrzeugen hingegen verspricht eine spezielle Tankkarte, die man über eine Mitgliedschaft als Betrieb im System des Anbieters erwerben kann, größere Vorteile.
Situation der Mitarbeiter
Während in großen Unternehmen der Einkauf über die entsprechende Abteilung läuft, werden im Mittelstand viele Einkäufe unmittelbar von Mitarbeitern getätigt, die gegen die Vorgabe des Kaufbeleges ihre Auslagen erstattet bekommen. Dabei setzen sie häufig ihre privaten Bonuskarten ein, wobei die finanziellen Vorteile, beispielsweise im Einzelhandel, gering sind.
Anders kann es bei Übernachtungen oder Flügen aussehen, wenn Mitarbeiter an Bonusprogrammen teilnehmen und mit einem gewissen Ehrgeiz darauf abzielen, bestimmte Umsatzhöhen oder Bonusgrade zu erreichen. Dann ist nicht auszuschließen, dass es zu Entscheidungen kommt, die für den Arbeitgeber von Nachteil sind. Denn je teurer der Flug oder die Unterkunft, desto höher die privat nutzbaren Boni für den Angestellten.
Wegen des Datenschutzes lässt sich die Nutzung solcher Programme nicht einfach nachweisen. Allerdings darf man den Mitarbeiter durchaus fragen, welche Gründe er für seine Auswahl des Hotels, des Fluges oder für den Kauf von Produkten bei bestimmten Anbietern hat. Kommen Zweifel auf, sollte man prüfen, ob ein unabhängiger Dienstleister, beispielsweise ein Reisebüro, nicht zu günstigeren Ergebnissen kommt.
Steuerliche Aspekte bei ausgewählten Bonusprogrammen
Was viele Energieberater nicht wissen: Bei vielen Bonusprogrammen und Bonuskarten ist Umsicht geboten, will man sich steuerlich korrekt verhalten. Diesbezüglich sollte man die einzelnen Programme im Detail betrachten.
Payback-Punkte
Werden bei dienstlichen Einkäufen durch einen Mitarbeiter Payback-Punkte gesammelt, entsprechen diese einem steuerpflichtigen Arbeitslohn. Dieser unterliegt der allgemeinen Steuerpflicht im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens, als auch der Beitragspflicht in der Sozialversicherung. Die 50-Euro-Sachbezugsfreigrenze (§ 8 Abs. 2 S. 11 EStG) ist nicht anwendbar, da der Arbeitnehmer sich die „erworbenen“ Punkte bar auszahlen lassen kann. Die für Sachbezüge aus Kundenbindungsprogrammen geschaffene Steuerbefreiungsnorm des § 3 Nr. 28 EStG ist nicht anwendbar. Es kann keine Pauschalierung im Sinne des § 37a EStG durch den Anbieter der Karten erfolgen.
Die Steuer- und Beitragspflicht als geldwerter Vorteil wird vermieden, wenn man dem Arbeitnehmer die private Nutzung beruflich gesammelter Payback-Punkte untersagt. Ist der Erwerb der Payback-Punkte gemischt veranlasst, wenn zum Beispiel vom Arbeitgeber mittels Tankkarte bezahltes Benzin sowohl für dienstliche als auch private Fahrten genutzt wird (Fahrtenbuch), sind die Payback-Punkte aufzuteilen. Dies ist gegebenenfalls sachgerecht abzuschätzen.
Die Vorteile aus den dienstlich erworbenen Payback-Punkten führen wie beschrieben zu Arbeitslohn und unterliegen bereits durch die Gutschrift auf dem privaten Punktekonto der Besteuerung. Dies hat die Finanzverwaltung festgelegt (vgl. BMF, 20.10.2006, IV C 5 – S 2334 – 68/06). Wird die „1-%-Methode“ für Firmenfahrzeuge genutzt, sind Payback-Punkte mangels Aufteilungsmöglichkeit immer als Arbeitslohn zu erfassen. Um den Lohnsteuerabzug folgerichtig vorzunehmen, muss der Mitarbeiter dem Arbeitgeber Höhe und Zeitpunkt der gewährten Prämien mitteilen. Dieser unterliegt einer gesetzlichen Anzeigepflicht gemäß § 38 Abs. 4 S. 3 EStG.
Reise- und Vielfliegerprogramme
Wer im Rahmen von Reise- oder Vielfliegerprogrammen auf Dienstreisen Punkte beziehungsweise Meilen sammelt und diese für privat genutzte Sachprämien verwendet, unterliegt mit diesem geldwerten Vorteil dem Freibetrag nach § 3 Nr. 38 EStG (1.080 Euro im Kalenderjahr) und kann vom Anbieter pauschal nach § 37a EStG besteuert werden, sodass für den Nutzer kein der Besteuerung zu unterwerfender Vorteil verbleibt. Eine pauschale Besteuerung setzt einen Antrag des Prämienanbieters voraus.
Bei dem Miles & More-Programm der Deutschen Lufthansa sowie dem Bahnbonusprogramm der Deutschen Bahn findet sich ein Hinweis auf die pauschale Lohnsteuerübernahme, weshalb durch Geschäftsreisen genutzte Bonuspunkte ohne Versteuerung privat genutzt werden können.
Nutzung für betriebliche Zwecke
Das Hessische Finanzgericht klärte, inwieweit Selbstständige, die Kosten für betriebliche Flüge durch die Inanspruchnahme von Bonusmeilen finanzieren, eine Betriebsausgabe vornehmen (vgl. Urteil vom 13.7.2021, 4 K 404/20). Der Selbstständige hatte einen dienstlichen Flug mit dienstlich gesammelten Bonusmeilen bezahlt und diese im Rahmen seiner Einnahmen-Überschussrechnung als Betriebsausgabe deklariert. Durch die betriebliche Nutzung sah er eine Einlage, welche durch Nutzung für einen weiteren dienstlichen Flug zu Betriebsausgaben wurden.
Das Finanzgericht sah durch die betriebliche Veranlassung beim Sammeln der Punkte deren Zuordnung zum Betriebsvermögen. Bei Nutzung zur Buchung eines weiteren dienstlichen Fluges stellen sie eine fiktive Betriebseinnahme dar, welcher die Kosten der Flugbuchung als Ausgabe gegenüberstehen. Im Ergebnis ist dieser Vorgang steuerneutral zu behandeln, da die letzte gebuchte Reise nach Ansicht der Richter bereits durch die vorherigen Buchungen und die gesammelten Bonusmeilen mitfinanziert wurde.
Der Vorteil der Pauschalbesteuerung beschränkt sich darauf, dass Bonusmeilen auch privat genutzt werden. Entsprechend wäre zu raten, diese Meilen privat zu nutzen und den betrieblichen Flug regulär zu buchen. So bleibt der Betriebsausgabenabzug möglich. Kostet der Flug zum Beispiel 800 Euro und beträgt der Grenzsteuersatz des Energieberaters 40 Prozent, ergibt sich aus der privaten Nutzung der Bonusmeilen ein Vorteil von 800 × 0,4 = 320 Euro.
Sollen heißt müssen, wenn können
Werden Bonusguthaben abgerufen, lassen sich diese sowohl geschäftlich als auch privat nutzen. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Bonusmeilen grundsätzlich dem Arbeitgeber zustehen, soweit dies nicht vertraglich anders geregelt ist (vgl. Urteil vom 11. 04.2006, 9 AZR 500/05). Betriebsvereinbarung formulieren häufig, dass Bonusmeilen vorzugsweise dienstlich genutzt werden „sollen“. Entgegen weit verbreiteten Ansichten ist „sollen“ keine unverbindliche Aufforderung. Sollen heißt müssen, wenn können.
Energieberater sollten aus steuerlichen Gründen Bonusguthaben für die private Lebensführung präferieren. Für geschäftliche Ausgaben hingegen das geschäftliche Konto nutzen, da nur so Ausgaben zu steuerrechtlichen Betriebsausgaben führen und nicht mit (fiktiven) Einnahmen aus dem Einsatz von Bonusguthaben verrechnet werden. Bei Payback-Punkten und sonstigen Vorteilen, die keine Sachbezüge, sondern einen Geldvorteil mit sich bringen, ist die korrekte lohnsteuerrechtliche Behandlung zu gewährleisten.




![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)