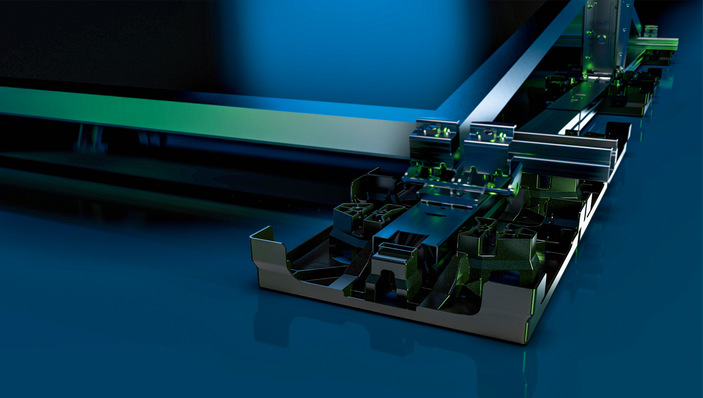Bild: privat
Es gebe zu wenige Lösungsansätze für den energetisch schlechten Gebäudebestand, sagt Frank Hettler, Bereichsleiter beim Informationsprogramm Zukunft Altbau, das Hauseigentümer in Sachen energetische Sanierung berät. „Viele Leute arrangieren sich nur mit Einzelmaßnahmen, wir brauchen aber Konzepte, die das ganze Thema insgesamt voranbringen.“ Eine Lösung könnte der so genannte Sanierungssprint sein. Mit dem Konzept, das Bauingenieur Ronald Meyer entwickelt hat, soll eine energetische Sanierung in gerade mal 22 Werktagen gelingen.
Entscheidend dabei ist eine gute Vorplanung. „Man braucht einen gewissen Vorlauf – in der Regel drei bis vier Monate“, berichtet Hettler. In dieser Zeit finden Ausschreibung und Vergabe statt sowie die Klärung von grundlegenden Fragen. „Man muss wissen, was bis wann angeschoben und entschieden werden muss.“
Ein weiterer wichtiger Faktor für den Sanierungsturbo: Die Gewerke arbeiten nebeneinander auf der Baustelle, nicht nacheinander wie im herkömmlichen Fließbandprinzip. Es geht darum, viele Handwerker gleichzeitig auf der Baustelle zu haben, die gemeinsam kooperativ ein Ziel verfolgen. Statt tagelang auf die nächste Bauetappe zu warten, übernehmen Teams nahtlos voneinander – oder arbeiten parallel in unterschiedlichen Bereichen des Hauses.
Wie der Sanierungssprint gelingen kann, zeigen erste Projekte, die vor kurzem in Baden-Württemberg abgeschlossen wurden. Im Esslinger Ortsteil Berkheim sowie im Stuttgarter Stadtviertel Bad Cannstatt wurden Einfamilienhäuser gemäß dem Konzept saniert. In beiden Fällen konnten die Sanierungsmaßnahmen im vorgegebenen Zeitrahmen umgesetzt werden.
Zentrales Element war ein Taktplan, der vorab entwickelt wurde und in Halbtagesschritte unterteilt war. Wie dieser umgesetzt wurde und welche Herausforderungen bei den Projekten zu bewältigen waren, darüber spricht Hettler in Folge 38: Sanierung in Höchstgeschwindigkeit des Podcast Gebäudewende.
Neben der Sanierung spielt die Nutzung von erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle in der Energiewende. Dabei kommt der Speichertechnologie eine hohe Bedeutung zu. Doch immer wieder verunsichern Berichte über Brände und Explosionen von Solarstromspeichern nicht nur Verbraucher:innen, sondern auch Energieberatende. Ralf Haselhuhn rät jedoch zu Gelassenheit. Im vergangenen Jahr habe es 58 Vorfälle gegeben. Bei 1,5 Millionen installierten Speichern in Deutschland sei dies eine „sehr kleine Nummer“, erklärt der Vorsitzende des Fachausschusses Photovoltaik bei der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS).
Nichtsdestotrotz sollten bei Betrieb und Installation einige Dinge in Sachen Sicherheit beachtet werden. Die DGS hat daher Fachregeln herausgegeben, die unter anderem Empfehlungen für die richtigen Standorte der Speicher enthalten. Sie sollten unter anderem so aufgestellt sein, dass sie weder besonders hohen noch besonders niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind. Auch sollte die Lüftung der Geräte nicht beeinträchtigt sein. „Ganz wichtig ist, dass Betreiber und Installateure die Vorgaben der Hersteller beachten“, sagt Haselhuhn.
In der Podcast-Folge 39: Solarspeicher sind sicher, aber nicht risikofrei erklärt er außerdem, warum ein Batteriemanagementsystem eine wichtige Rolle für einen sicheren Betrieb spielt und worauf man bei der Auswahl eines Speichers achten sollte.
GEB Podcast
Im Podcast Gebäudewende diskutiert GEB-Redakteur Markus Strehlitz mit Gästen aus Forschung, Politik und Wirtschaft über Aktuelles beim energieeffizienten Bauen und Sanieren. Dazu gehören beispielsweise Lowtech-Konzepte für Gebäude und Innovationen bei der Anlagentechnik. Auch die Aufgaben der Energieberatung, die Chancen von Wasserstoff in Quartierskonzepten und die Notwendigkeit der Effizienz zum Erreichen der Klimaziele sowie die serielle Sanierung waren bereits Themen. Die mittlerweile 39 Episoden finden Sie im Überblick unter www.geb-info.de/podcast und unter dem Stichwort „Gebäudewende“ auf allen gängigen Podcast-Plattformen.