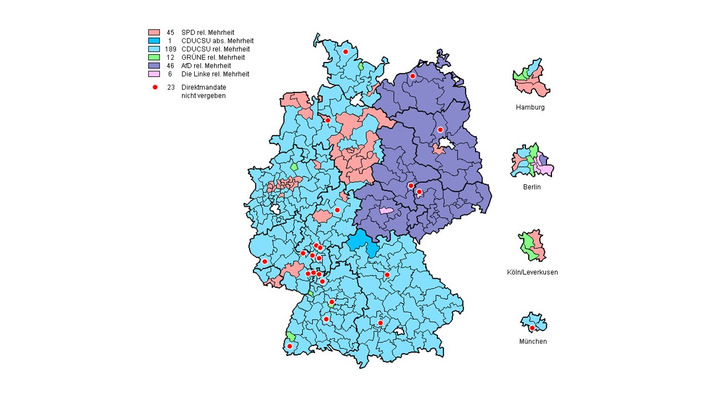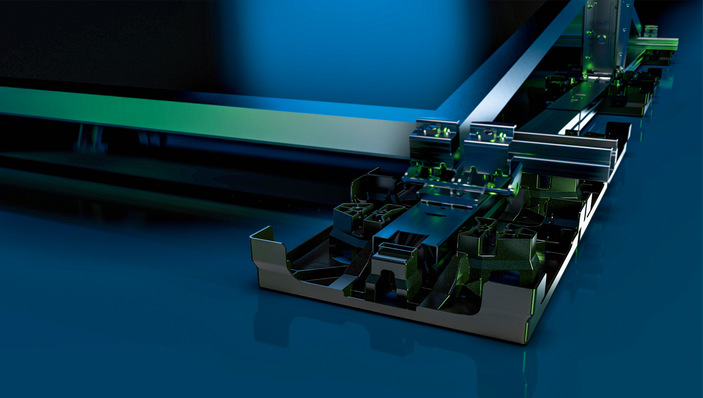Denkmalschutz ist Ländersache, weshalb jedes Bundesland anders mit den Denkmalschutzpreisen umgeht. Die einen prämieren eher die Objekte; die anderen Personen, die sich für deren Erhalt einsetzen, also Planer und Eigentümer, und die dafür nötige Handwerkskunst, sprich die Handwerker.
Übergeordnet ehrt und prämiert das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) mit dem Deutschen Denkmalschutzpreis den bürgerschaftlichen Einsatz für den Schutz, die Pflege und die dauerhafte Erhaltung unseres Kulturerbes in vier unterschiedlichen Kategorien. Die Preise für 2024 wurden am 28. Oktober in Mainz verliehen – alle Details hierzu, sowie die Ausschreibung für das kommende Jahr, sind der Homepage www.deutscher-preis-denkmalschutz.de zu entnehmen.
Wie die Länder mit prämierungswürdigen Denkmalprojekten umgehen, zeigt beispielhaft für Baden-Württemberg der Schwäbische Heimatbund, der gemeinsam mit dem Landesverein Badische Heimat und finanziell unterstützt von der Wüstenrot Stiftung den Peter-Haag-Preis für privates Engagement in der Denkmalpflege vergibt. Im Jahr 2024 wurden insgesamt fünf private Eigentümerinnen und Eigentümer für beispielhafte Sanierungen denkmalgeschützter Gebäude geehrt. Eines davon, der Farnrainhof in Elzach-Yach im Landkreis Emmendingen, stellen wir im Schwerpunkt dieses Heftes ab Seite 14 im Detail vor. Die anderen vier ausgezeichneten Projekte stellen wir im Nachgang kurz vor.
„Alte Münz“ in Wertheim
Die beiden Gebäude – ein steinernes mit Treppengiebel, erbaut 1261 vermutlich als Schultheißamt der Grafen von Wertheim, und ein 1587-89 angefügter Schmuckfachwerkbau für den Schultheiß und Tuchscherer Peter Heußlein – beeindrucken nicht nur wegen ihrer bewegenden Baugeschichte im Wertheimer Stadtbild. Bemerkenswert ist auch ihr nahezu originaler Zustand ohne durchgreifende Umbauten. Nach langjährigem Leerstand fand sich auf Initiative von Harald Brode – der bereits viermal den Denkmalschutzpreis abgeräumt hat – eine Gruppe engagierter Bürger und Bürgerinnen, die 2017 die historisch wertvolle Immobilie als Eigentümergemeinschaft kaufte. Im Inneren stieß man auf bislang unbekannte Befunde, wie zum Beispiel den „Pietra-Rasa“-Verputz mit Kellenritzungen der Fugen, der tatsächlich noch aus der Bauzeit des steinernen Hausteils im 13. Jahrhundert stammt. Die Bauherrschaft ließ diese Befunde aufwändig freilegen und professionell sichern. Sie verzichtete zudem auf jeglichen Dachausbau, ebenso auf größere Grundrissänderungen. Die Wohnnutzung wurde auf unbedenkliche Bereiche im Fachwerkteil eingeschränkt, im Steinhaus entstanden Konferenzräume sowie mehrere Büros mit anmietbaren PC-Arbeitsplätzen.
Ehemaliges Forsthaus in Neuweiler-Agenbach
Ursprünglich war das Forsthaus Teil eines Gutes, das sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt. Errichtet wurde der Bau im Jahr 1785, wie eine Datierung über dem Kellereingang dokumentiert. Auf dem steinernen Sockelgeschoss, in dem sich die Ställe befanden, ruht ein verschindeltes Wohngeschoss, geschützt von einem hohen Satteldach mit verbretterten Giebeln. Im Zuge eines Umbaus im Jahr 1830 wurden der Eingang verlegt und das firsthohe mächtige Zwerchhaus auf der Ostseite hinzugefügt. Die Familie Mahle erwarb das Anwesen 1999 und sanierte es mit hohem gestalterischen Anspruch über ein Vierteljahrhundert hinweg. Den Anfang machte die Reparatur des großflächigen Daches inklusive kaum wahrnehmbarer Aufdachdämmung, verbunden mit dem Zubau von sechs kleinen Gauben auf der Westseite, deren Größe auf Zwischensparrenbreite reduziert blieb. Unterm Dach blieb in den neu gewonnenen Räumen bewusst der Dachbodencharakter bewahrt. Die Fenster im Dachgeschoss aus den 1950er-Jahren wurden ersetzt, der nicht mehr tragfähige Boden in der Küche verstärkt. Weitere Arbeiten erfolgten 2011 bis 2014 sowie 2021 bis 24 mit der Erneuerung von Sanitärbereichen, dem Austausch von nicht passenden Türen und Fenstern sowie einem Außenanstrich, der einem älteren Befund entspricht. Eine Stückholz-Zentralheizung sowie der erneuerte Kachelofen beheizen das Gebäude, ein 3.500 Liter fassender Pufferspeicher ergänzt das Konzept.
Ehemalige Reithalle in Achern
Die Käufer dieses Kulturdenkmals – Astrid und Gerold Weber – ließen sich mit der früheren Reithalle schroffer Bauart zum wiederholten Mal auf einen geschichtsträchtigen Bau auf dem Gelände der früheren Heil- und Pflegeanstalt Illenau in Achern ein. Seit Mitte der 1990er-Jahre ungenutzt, geriet es in einen immer problematischeren Zustand. Die sparsame Konstruktion aus unverputzten Wänden mit sichtbarem Skelett in einfachem Stampfbeton, ausgemauert mit groben Backsteinen und stützenlos überspannt von einem gewaltigen offenen Dachwerk aus Bretterbindern, gab das Jahr der Entstehung vor: Im Notjahr 1946, als die 1842 erbaute Illenau von der französischen Armee beschlagnahmt und zur Offizierschule umfunktioniert worden war, brauchte es für diesen Zweck eben auch eine Reithalle.
Die angestrebte Mischnutzung erlaubte den schonenden Umgang mit der originalen Bausubstanz. Eine Markthalle mit Dauerständen für regionale Bioprodukte nimmt den größten Teil des Gebäudes ein, ergänzt durch eine Buchhandlung und ein Café, das im Außenbereich auch eine ehemalige Militärtankstelle aus den 1950er-Jahren nutzt. Drei zweigeschossige Einfamilienhäuser in Holzbauweise sind wie Container in den hinteren Teil der Halle eingestellt, ebenso zwei Einbauten für Büros, geschickt beleuchtet durch neue Fensterelemente in den seitlichen Hallentoren, die offenstehend auch erhalten blieben. Komplett neu ist der firstnahe Einbau von Lichtbändern in die beiden riesigen Dachflächen. Bündig eingesetzt und mit in das Glas integrierten PV-Modulen passen sie zu dem Gesamtbild und fallen nicht störend ins Auge. Heizwärme und Warmwasser für die Wohnungen und Büros liefert die zentral in der Halle positionierte Holzpelletanlage.
Backhausareal in Salem-Neufrach
Drei malerisch beieinander gruppierte Häuschen auf einem ansteigenden Grundstück bilden das Backhausareal in Neufrach, heute Stadtteil von Salem nördlich des Bodensees. Alle drei Gebäude – ein Backhaus, ein Schopf und ein kleines Fachwerkhaus – gehörten einst zu einem großen Bauernhof, der, nicht als Kulturdenkmal eingestuft, einem wenig ins Ortsbild passenden Neubau mit Eigentumswohnungen weichen musste. Die Familie von Christina Hopstock rettete das zwischen 1811 und 1857 errichtete Ensemble und sanierte es ohne Eile in Etappen von 2019 bis 2021. Alle Arbeiten erfolgten unter der Prämisse, die Originalsubstanz zu erhalten, so zum Beispiel auch die alten handgestrichenen Dachziegel. Unrettbare Teile wurden mit gleichem Material und in der gleichen handwerklichen Technik erneuert, etwa der Außenputz. Den Ofen wieder gangbar zu machen, um ihn unter den heutigen Bauauflagen reaktivieren zu dürfen, erwies sich als besondere Herausforderung. Im Backhaus wird nun sechs Mal im Jahr wieder gebacken, während das kleine Haus lokalen Vereinen und einem in der Gründung befindlichen Backhausverein als Versammlungslokal dient. si