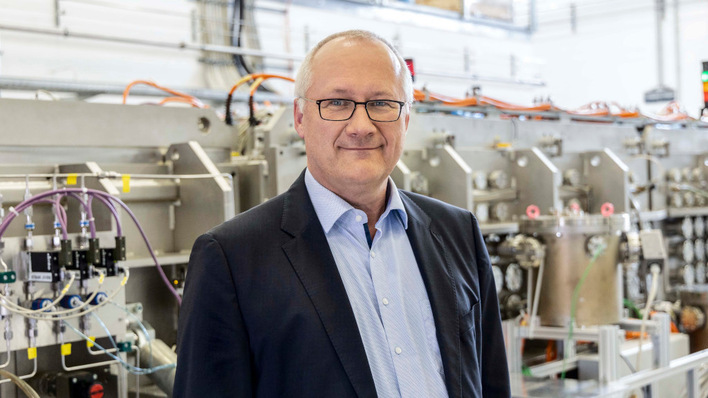In Konzepten für künftige klimaneutrale Städte, aber auch in zahlreichen Beiträgen jüngster Architekturwettbewerbe, werden Quartiere und Siedlungen immer grüner. Insbesondere die Dächer mutieren zu blühenden Wiesen oder gar baumbewachsenen Parklandschaften. Dabei fällt auf, dass oftmals die bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) eher am Rande thematisiert wird.
Dabei stellen Solarsysteme für den Gebäudebereich wichtige und leistungsfähige Bausteine für eine technisch und wirtschaftlich machbare, zu 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung dar. Thermische Solarkollektoren und vor allem PV-Module sind wichtige Elemente des solaren Bauens und gelten mittlerweile als selbstverständliche Bestandteile energieeffizienter Gebäude und avancierter Hüllflächenkonstruktionen [1].
Um den Energiebedarf in dicht bebauten Städten mit steigender Stockwerkszahl decken zu können, reichen die vorhandenen Dachflächen für die notwendige Photovoltaik häufig nicht mehr aus. Durch die zusätzliche Belegung der Fassade können weitere Flächen für die Stromproduktion aktiviert werden. Damit rückt die solare Energiegewinnung in die Wahrnehmung der Bewohner und wird auch in Stadtraum und Quartiersumfeld sichtbar.
Für eine schlüssige Weiterentwicklung der Baukultur ist Gestaltung ein zentrales Thema – ob bei Neubau- oder Sanierungsprojekten. Daher muss bei einer architektonischen Integration von Photovoltaik ein besonderes Augenmerk auf der optisch-ästhetischen Integration liegen, damit PV-Anlagen nicht wie Fremdkörper wirken, sondern einen integralen Bestandteil von Dach und Fassade darstellen [2].
Auch Grünfassaden kommen in den vergangenen Jahren weltweit immer häufiger beim Bau moderner, energieeffizienter Gebäude zum Einsatz, weil Pflanzen als multifunktionales Gestaltungselement sich ideal für ein ökologisches Konzept anbieten. Aufgrund adiabatischer Kühlprozesse können Fassadenbegrünungen als natürliche Klimaanlagen in der Stadtplanung eingesetzt werden und dem Effekt urbaner Hitzeinseln entgegenwirken [3]. Dabei erfüllen sie eine Vielzahl weiterer Funktionen wie natürliche Luftfilterung von Feinstaub, Aufnahme von Kohlenstoffdioxid, Schallreduzierung oder Verbesserung der winterlichen Wärmedämmeigenschaften von Fassaden. Zudem lassen sich die Temperaturen an den Fassadenoberflächen reduzieren [4].
Um die solare Einstrahlung optimal zur Erzeugung von Strom zu nutzen, sind die Faktoren Ausrichtung, Modulwirkungsgrad, Sonneneinstrahlung ausschlaggebend. Ein zentraler Einfluss kann auch die Modulerwärmung über 25 Grad Celsius sein. Kristalline PV-Module reagieren eher empfindlich auf Temperaturerhöhung, das heißt je kühler die Einbausituation, desto effizienter lässt sich Solarstrom produzieren. So kann in den Sommermonaten, in denen viel energiereiche Strahlung vorhanden ist, ein begrüntes Umfeld eine bessere „Performance“ der Photovoltaik ermöglichen.
Multifunktionalität und Plus-Nutzungen mindern Flächenkonkurrenz
Um die Ziele der Energiewende und des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen, ist eine enorme Zubaurate bei der Photovoltaik im Gebäudebereich zwingend notwendig. Professor Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin bilanziert insgesamt eine erforderliche Neuinstallation bis 2035 von etwa 590 Gigawatt, was rund einem Faktor 10 mehr als der aktuellen PV-Leistung entspricht [5]. Die Flächen sind vorhanden, zumindest was das „technisches Potenzial an installierbarer Leistung“ betrifft. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesystem errechnete für die BIPV auf Dächern ein Potenzial von 560 Gigawatt und an Fassaden von 440 Gigawatt [6].
Allerdings sind Fassaden gegenüber Dächern durch eine Vielzahl zusätzlicher (multi-)funktionaler Ansprüche charakterisiert. Und beim wichtigsten baulichen Subsystem, mit verschiedensten Schutz- und Steuerungsaufgaben für Energieeffizienz und Nutzerkomfort, entstehen im Zuge von Klimaanpassungsstrategien auch verstärkt Flächenkonkurrenzen. Das erfordert in verstärktem Maße die Untersuchung von sogenannten Plus-Nutzungen, um auf begrenzten Gebäudeflächen möglichst effektive und wirksame Fassadenlösungen realisieren zu können, zum Beispiel die Verbindung von Begrünung und Photovoltaik.
Die Kombination stellt kein komplett neues Arbeitsfeld für Architekt:innen dar, da bereits in Wettbewerbsprojekten angedacht und auch in Gebäuden vereinzelt realisiert. Beim Smart Material House „Smart ist grün“ von zillerplus Architekten aus München, 2013 zur Internationalen Bauausstellung (IBA) in Hamburg realisiert, zeigen sich bereits gestalterisch interessante Ansätze. Die Kombination von Fassadenbegrünung und Photovoltaik wird jedoch in separaten Bereichen ohne spezifischen Bezug auf die Kühlleistung der Vegetation eingesetzt.
Dieser Einfluss ist indessen bei der Ausführung von Flachdächern bereits untersucht. Dabei zeigt sich, dass teilweise und in Abhängigkeit von unter anderem der Witterung oder der Dicke der Substratschicht eine leistungssteigernde Wirkung bei PV-Modulen besteht. „Die Stromproduktion wird bei kombinierten Anlagen dadurch gesteigert, dass die begrünte Oberfläche über die Verdunstung des gespeicherten Regenwassers eine Abkühlung der Panels bewirkt“, heißt es in einer Schweizer Publikation [7]. Jedoch fallen diese Effekte nach Auswertung umfangreicher praxisnaher Versuchsanordnungen in der Schweiz mit knapp ± zwei Grad Celsius eher gering aus [8].
Den Kühleffekt durch Begrünungen hat ein Projekt nachgewiesen. Der im Januar 2019 gegründete Forschungsbereich „Ökologische Bautechnologien“ an der Technischen Universität Wien hat für experimentelle Studien einen „Öko-Freiland-Prüfstand“ errichtet. Ziel der Aktivitäten ist es, ein multifunktionales System zu entwickeln, das eine optimale, langlebige, kostengünstige und energieeffiziente Lösung für Neubauten sowie die Bestandssanierung darstellt. Untersucht werden unter anderem die Einflüsse einer „grünen Pufferzone“ (bodengebundene Fassadenbegrünung) auf die Temperatur von PV-Modulen.
Dabei wird deutlich, dass die Pflanzen hinter der Photovoltaik in ihrem Wachstum kaum eingeschränkt werden und grundsätzlich temperaturregulierend auf die PV-Module (ein bis vier Grad Celsius) wirken. Dieser Einfluss wird umso ausgeprägter, je extremer die Außentemperaturen sind. Moren und Korjenic stellen abschließend heraus, dass gerade zur Beurteilung der komplexen Schnittstelle von Photovoltaik und Fassadenbegrünung zusätzliche Forschungsarbeiten erforderlich sind [9].
Grünfassaden im Test
Das Verbundvorhaben „EnOB: GreenFaBS“ (02/2019 – 07/2021) [10] der Technischen Hochschule Nürnberg (THN) und des Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP in Holzkirchen beschäftigt sich mit zwei Fassadentechnologien, die im Bereich der energieeffizienten Gebäudekonditionierung bisher nur getrennt eingesetzt werden: Grünfassaden und dezentrale Fassadenlüftung (DFL).
Experimentelle Studien mit vier Begrünungssystemen an einem Fassadenversuchsstand auf der Freifläche des THN-Technikums in Rednitzhembach, der im Zuge des Projekts errichtet werden konnte, sowie thermisch-dynamische Simulationsberechnungen bestätigen in der Kühlperiode von Mai bis September ein Einsparpotenzial beim Kühlenergiebedarf und bei den CO₂-Emissionen für die Musterräume des Versuchsstands zwischen 23 und 43 Prozent. Im Vergleich zu den Ergebnissen für den Fassadenversuchsstand stellen sich für das simulierte Einzelbüro, aufgrund abweichender baukonstruktiver Parameter, aber geringere Einsparpotenziale zwischen sieben und 25 Prozent ein.
Weitere Untersuchungen am VERU-Versuchsgebäude des IBP belegen unter anderem zwei Effekte durch die Pflanzen. Einerseits führt die Begrünung zu einer Reduzierung der Ansauglufttemperatur der DFL-Geräte. Sie sind um bis zu vier Kelvin niedriger als beim Referenzraum. Andererseits trägt die Verschattung zu einer niedrigeren Fassadentemperatur bei, wodurch sich die solaren Einträge in den Raum reduzieren [11].
Im Rahmen der kleinen Projektstudie „GreenPV“ (04/2021 – 08/2022) [12] werden die Versuchsarbeiten um die Kombination Photovoltaik und Begrünungsvarianten erweitert. Dabei sind an dem THN-Fassadenversuchsstand semitransparente PV-Module der Firma Aleo Solar aus Prenzlau eingesetzt worden. Durch die rahmenlose Konstruktion und die transparente Rückseite ist eine ausreichende Solarstrahlung für die dahinter angeordneten Pflanzen sichergestellt.
Gegenüber den Untersuchungen an der TU Wien werden drei Fassadenbegrünungsvarianten – wand- und bodengebundene Begrünung, Misch-/Regalsystem – für die Projektarbeiten eingesetzt. Vor allem von Interesse sind zwei wandgebundene Systeme, die gegenüber bodengebundenen Systemen über eine höhere Kühlleistung verfügen:
Der Ansatz zielt auf Synergieeffekte durch die Nutzung der jeweils positiven Eigenschaften beider Fassadensysteme: die Photovoltaik als hochentwickelte, technische Komponente und wesentlicher Baustein einer dezentralen, gebäudenahen Energieversorgung und die vertikale Begrünung zur Verbesserung des wohnungsnahen Umfelds mit den Potenzialen zur passiven Kühlung.
Die experimentelle Untersuchung der Kombinationen soll klären, in welcher Größenordnung solare Erträge durch die Kühleffekte gerade von wandgebundener Fassadenbegrünung gesteigert werden können. Auch werden die Auswirkungen des Fassadenzwischenraums hinter dem PV-Modul auf die Pflanzen beobachtet. Die bisherigen Erfahrungen mit der Kletterpflanze Amerikanische Pfeifenwinde (Aristolochia durior) versprechen positive Einflüsse.
Im Projekt sollen die aus den Vorarbeiten gewonnenen Erfahrungen auf ein Fassadenkonzept übertragen werden, dessen Leistungsfähigkeit in experimentellen Studien in dieser Form noch nicht überprüft wurde. Die Gestaltung der Lagebeziehungen zwischen Photovoltaik und Grünfassade ist ebenfalls Teil der Untersuchungen und wird in Abhängigkeit des Begrünungssystems betrachtet.
Fassaden-Baukasten soll bei Planung helfen
Noch immer scheuen viele Planer:innen im Fassadenbereich sowohl den Einsatz von Begrünung (insbesondere wandgebundener Systeme) als auch den von Photovoltaik, begründet häufig durch deren hohen Komplexitätsgrad und der mitunter schwierigen Gewerkeschnittstellenproblematik. Aber angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen von Energiewende und Klimaanpassungsstrategien gewinnen beide Techniken enorm an Relevanz und gerade ihre Kombinationsmöglichkeiten eröffnen ein zusätzliches Spektrum von positiven Effekten.
Die technisch plausibel verfügbaren Flächen für gebäudeintegrierte Solartechnik in Deutschland sind enorm. Dieses Potenzial gilt es sowohl effizient und effektiv als auch gestalterisch ansprechend zu nutzen. Dazu ist es erforderlich, die Bandbreite der einsetzbaren Techniken sowie deren Kombinationsmöglichkeiten kontinuierlich zu erweitern. Hier leistet das Projektvorhaben wichtige Grundlagenarbeit, da über die Umsetzung eines praxisnahen Versuchsaufbaus eine technische Machbarkeit aufgezeigt werden soll, aber insbesondere die prognostizierten Synergieeffekte quantitativ ermittelt werden.
Ergebnisse der durchgeführten thermisch-energetischen Gebäudesimulation im GreenFaBS-Projekt zeigen, dass eine vollflächig – geschosshoch, ein Fassadenraster – installierte Begrünung einen größeren Effekt aufweist als ein nur im Brüstungsbereich vorgesehenes System. Jedoch fällt diese Wirkung hinsichtlich des Energiebedarfs im Wesentlichen gering aus. Eine großflächig begrünte Fassade führt zu einem um vier Prozent geringeren Kühlenergiebedarf. Bei der Reduzierung der Begrünungsfläche von einem geschosshohen Fassadenfeld auf den Brüstungsbereich um etwa zwei Drittel entsteht ein vergleichsweise nur geringer Kühlenergiemehrbedarf. Dies ermöglicht bei der Planung von Funktionsflächen in der Fassade – unter den gegebenen Rahmenbedingungen wie dem U-Wert der Konstruktion – gewisse Freiheitsgrade.
Diese Flächen könnten zusätzlich für den Einsatz von Photovoltaikmodulen genutzt werden. Denn bei flächenparalleler Anordnung sind Fragen der Zugänglichkeit für die regelmäßige Pflege von Pflanzen und Wartung der Systemtechnik zu berücksichtigen. Ebenfalls nimmt der positive Einfluss der Kühlleistung der Begrünung auf den gebäudenahen Außenraum bei einem großflächigen PV-Einsatz in der Fassade ab.
Angesichts der anstehenden zentralen Aufgaben im Baubereich, gleichermaßen bei Neubauten und in der Bestandssanierung, ist das Thema der Fassadenkonkurrenz bedeutsam: Welche Flächen benötigen die verschiedenen Schnittstellen beziehungsweise Plus-Nutzungen, um den Anteil beider Fassadentechniken zu optimieren? Daher gilt es die Entwicklung von multifunktionalen Energiefassaden, insbesondere auf Basis der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF), um Begrünungstechniken zu erweitern. Ziel erster Konzepte und Kooperationen ist eine Art Fassaden-Baukasten, um die Potenziale künftiger Lösungen effektiver auf die jeweiligen standortspezifischen Besonderheiten abstimmen zu können.
Literatur
[1] Krippner, Roland (Hrsg.): Gebäudeintegrierte Solartechnik. Architektur gestalten mit Photovoltaik und Solarthermie. Detail green books. München 2016
[2] Ausgezeichnete Beispiele zeigen unter anderem die Preisträger der jüngsten Ausschreibung des Solarenergiefördervereins Bayern e. V: Architekturpreis Gebäudeintegrierte Solartechnik 2022. www.sev-bayern.de <06.01.2023>
[3] Untersuchungen des Zentrums Stadtnatur und Klimaanpassung an der Technischen Universität München zeigen, dass Pflanzen in der Vertikalen insbesondere in verdichteten Stadtteilen mit Blockrandbebauungen wichtige Elemente zur Reduzierung von „Hitzestress im Außenraum“ darstellen. Lang, Werner; Pauleit, Stephan: Leitfaden für klimaorientierte Kommunen in Bayern. Technische Universität München (Hrsg.). München, 2020, S. 40 f.
[4] Begrünte Fassaden. In: Herzog, Thomas; Krippner, Roland; Lang, Werner: Fassaden Atlas. Edition Detail. München 3/2020, S. 336-341
[5] www.t1p.de/geb230161 <06.01.2023>
[6] Wirth, Harry et al.: Potenziale der Integrierten Photovoltaik in Deutschland. In: 36. PV-Symposium / BIPV-Forum. Online, 18. - 26. Mai 2021. Tagungsband. Pforzheim 2021, S. 209–228 [S. 216]
[7] Brenneisen, Stephan: Naturschutz auf Dachbegrünungen in Verbindung mit Solaranlagen. Hrsg. v.: Baudepartement Basel-Stadt. Informationsblatt. Basel, o. J.
[8] Baumann, Thomas et al.: Performance Analysis of PV Green Roof Systems. [5CO.14.3]. In: 32nd EU PVSEC [European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition]. Munich, 20-24 June 2016. Proceedings. München 2016, S. 4
Diese Einschätzungen wurden beim BuGG-Fachkongress „Solar-Gründach“ im Oktober 2022 in Berlin von Andreas Dreisiebner (Solarspar, Sissach/CH und Growsolutions, Seuzach/CH) nochmal bestätigt.
[9] Moren, María Soledad Penaranda; Korjenic, Azra: Green buffer space influences on the temperature of photovoltaic modules. In: Energy and Buildings, 146/2017, S. 364–382.
[10] www.th-nuernberg.de/fakultaeten/ar/forschung/konstruktion-und- technik/abgeschlossene-forschungsprojekte/enob-greenfabs/ <06.01.2023>
[11] Krippner, Roland; Franz, Mario; Schade, Almuth; Sinnesbichler, Herbert; Stephan, Wolfram; Bott, Boris: Reduzierung des Kühlenergiebedarfs dezentraler Fassadenlüftung. Fassadenbegrünung und Gebäudetechnik. In: GebäudeGrün. Dach Fassade Raum Grün, 2/2022, S. 26–31
[12] www.th-nuernberg.de/fakultaeten/ar/forschung/konstruktion-und- technik/laufende-forschungsprojekte/green-pv/ <06.01.2023>
Bei dem Beitrag handelt es sich um eine gekürzte und überarbeitete Fassung von Krippner, Roland: Photovoltaik und Fassadenbegrünung. Über Potenziale aktueller Lösungen zur Klimaanpassung und -neutralität. In: 37. PV-Symposium/BIPV-Forum. Freiburg i. Br.: Messe Freiburg & online, 21. - 23. Juni 2022. Tagungsband. Pforzheim: Conexio GmbH, 2022, S. 431-441.

Bilder: Roland Krippner
GEB Dossier
Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Fassade mit -Beiträgen und News aus dem GEB:
www.geb-info.de/fassade