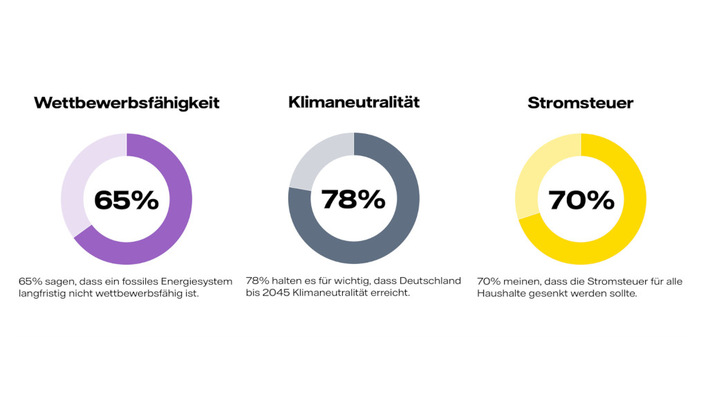Das dritte Unternehmensbilanzquartal habe den Herstellern von Windenergieanlagen außerhalb Chinas 77 Prozent mehr neue Auftragswerte in den Bestellungseingängen beschert als im Quartal davor. Ein in Branchenschätzungen auf elf Prozent prognostiziertes Umsatzwachstum dürften die Anlagenunternehmen Ende des Jahrs 2025 erreicht haben – drei Prozentpunkte höher als 2024. Wieder fast aufs Kostenniveau unmittelbar vor der weltweiten Coronaseuche zurückgefallen seien die Stahlpreise als ein Hauptindikator für die Turbinenbaukosten. Sie seien nach einem inzwischen 55-prozentigen Preisrückgang seit dem Höchststand der Stahlpreise im April 2024 infolge des Kriegsbeginns in der Ukraine wieder „annähernd auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt“. So schreibt es das Frankfurter Fonds-Anlageunternehmen Seahawk Investments in seiner vierteljährlichen Marktanalyse Quarterly Note.
Ausland und Gigawattdimension: Neue Windturbinenflaggschiffe erobern Markt
Positives Duo: Auch Nordex meldet Durchbruch zum wieder profitablen Turbinengeschäft
Die zum Seuchenschutz aufgrund der auferlegten Bewegungsbeschränkungen gestoppten weltweiten Rohstofftransporte mit ihren preistreibenden Effekten hatten ab 2020 die Stahlpreise erstmals kräftig ansteigen lassen. Nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs und damit dem Ausfall des angegriffenen Stahlproduktionsstandortes Ukraine als Exportland ebenso wie nach dem einhergehenden Stopp von Stahlimporten aus Russland als europaweite Maßnahme gegen das angreifende Land waren die Stahlpreise noch einmal explodiert. Windturbinenbauer, hatten Preisveränderungen zunächst nicht an die Windparkkunden weiterreichen können, die Zuliefererverträge enthielten oft keine entsprechenden Preisausgleichklauseln. Windturbinenhersteller waren in die Krise geraten, weil Margen im Umsatz verloren gingen, während zusätzlich ein starker Ausschreibungswettbewerb um wenige Windparkprojekte sie zu sehr schnellen Entwicklungen immer größerer Turbinen trieben mitsamt neuer technologischer Risiken.
Inzwischen seien die Windturbinenpreise innerhalb der vergangenen fünf Jahre aber wieder um 30 Prozent angezogen, weil die Anlagenhersteller die Kostenerhöhungen im Markt an die Kunden wieder weiterreichen können. Nun dürften auch bei den weltweiten Windparkinstallationen nach einer Verlangsamung des Wachstums in der Zeit von 2021 bis 2023 wieder „günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und politische Unterstützung“ wirksam werden. Sie dürften „das Wachstum im Zeitraum 2025 bis 2027 wieder ankurbeln“, notiert Seahawk.
Weil dennoch die Stromgestehungskosten eines neuen Onshore-Windparks an Land mit 6,1 US-Cent pro eingespeiste Kilowattstunde (kWh) nur leicht angestiegen sei, so stellen es die Fondsspezialisten ihren Anlege-Kunden dar, sei die Energie inzwischen etwa so günstig wie die aus einer neuen Solaranlage. Bei damit um 50 Prozent günstigeren Stromerzeugungskosten im Vergleich zu Kohlestrom sei die Windkraft dennoch wettbewerbsfähig. Mit Stromgestehungskosten für Meereswindkraftanlagen von 17,3 US-Cent pro kWh sei Offshore-Windstrom zwar noch teurer als konventionell erzeuge Elektrizität. Doch dürfe bei zu erwartenden Kostensenkungen aufgrund bevorstehender Skaleneffekte der weltweit zunehmenden Meereswindparkprojekte in Gigawattgröße die Branche auch hier absehbar von Zugewinn an Wettbewerbsfähigkeit profitieren.
Seahawk vergleicht schließlich auch drei verschiedene Performance-Index-Kurven zu wirtschaftlichen Perspektiven der Windturbinenbauer im Vergleich zu konventionellen Energieerzeugern und einem von der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Bloomberg geführten Index verschiedener großer Wertpapiere ausschüttender Unternehmen. Demnach stieg der Bloomberg Wind Aggregate Equal Weight als Index wichtiger Windturbinenhersteller seit April stetig an auf ein inzwischen um bis zu 35 Prozent erhöhtes Niveau, während die anderen Indizes sich um rund 20 bis sogar im Falle des von Ölunternehmen dominierten Index konventioneller Energiewirtschaftsunternehmen nur gut 5 Prozent nach oben bewegen.
Allerdings zeigten nun zwei Offshore-Windenergieanlagen-Hersteller, dass sie dennoch Investitionen in neue Fertigungskapazitäten vorerst scheuen. So hatte der langjährige und außerhalb Chinas weiter bestehende Weltmarktführer Vestas zu Mitte Oktober den Stopp der Planung einer Rotorblattfertigung in Polen gemeldet. 2024 hatte Vestas die Fabrik für das eigene Top-Meereswindkraftmodell V236 mit 15 Megawatt (MW) Nennleistung angekündigt, die vor der polnischen Küste im ersten Meereswindpark des Landes Baltica ab 2026 zum Einsatz kommen wird. Eine Woche später folgte Siemens Energy mit der Windturbinensparte Siemens Gamesa: Das Unternehmen meldete, eine geplante Maschinenhausmontage in einer neuen Fabrik im dänischen Esbjerg für die getriebelose Anlage SG 14-236 im begonnenen Windparkbau des Offshore-Windfeldes Thor doch nicht zu bauen.