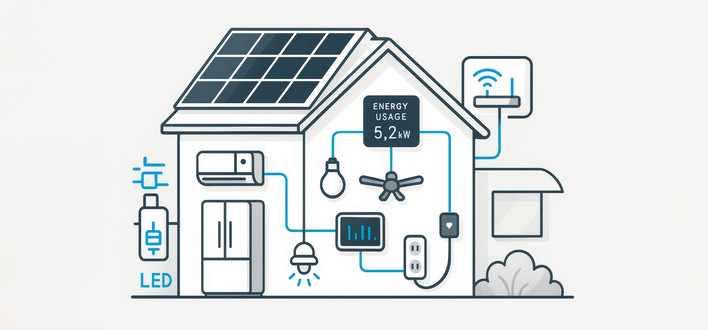Übergeordnetes Ziel der reformierten Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist es geblieben, bis 2045 Klimaneutralität im Gebäudebestand zu erreichen. Neben dem Ordnungsrecht stellt das Programm ein zentrales politisches Instrument dar, das mit einem Budget von 13 Milliarden Euro für 2023 entsprechende Anreize im Markt setzen soll. Mit der zweiten Reformstufe wird der Zugang zur BEG weiter erleichtert, Förderboni erhöhen die Anreize für Sanierungen und die Fördereffizienz des Programms wird erneut gesteigert, um möglichst viele Antragstellerinnen und Antragssteller unterstützen zu können.
Änderungen BEG-Richtlinie Nichtwohngebäude
Gefördert werden die energetische Sanierung und der Ersterwerb von sanierten Bestandsgebäuden, die nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme erstmals den energetischen Standard eines Effizienzgebäudes
erreichen (EE = Erneuerbare Energien; NH = Nachhaltigkeit).
Der Bereich Lüftungstechnik ist Bestandteil der Richtlinien-Anlage „Technische Mindestanforderungen“. Gemeint sind damit die technischen Anforderungen zu den einzelnen Fördertatbeständen, beispielsweise zu den Anforderungen an eine Effizienzgebäude-Stufe.
Unverändert geblieben ist der grundsätzliche Abschnitt: „Bei der Realisierung von Effizienzgebäuden ist stets zu prüfen, ob die Luftvolumenströme den Anforderungen des Gebäudes entsprechen oder Maßnahmen zur Vermeidung von Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung erforderlich sind. Hierzu ist ein Lüftungskonzept zu erstellen, in dem der erforderliche Außenluftvolumenstrom und die Lösung zur Umsetzung spezifiziert werden. Hieraus resultierende Maßnahmen sind umzusetzen. Auf eine wärmebrückenminimierte und möglichst luftdichte Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik ist zu achten. Die Volumenströme raumlufttechnischer Anlagen sind abzugleichen und die Dichtheit des Luftleitungssystems ist nachzuweisen.“
Änderungen gibt es im Abschnitt 3 Erneuerbare Energien-
Klasse (EE-Klasse). Neu ist neben dem erhöhten Anteil von
65 Prozent auch die Möglichkeit der Wärmerückgewinnung aus Lüftungsanlagen zur Deckung des errechneten Wärme- und Kälteenergiebedarfs. In der Richtlinie heißt es: „Bei den Zusatzanforderungen an den Einsatz von Wärme aus erneuerbaren Energien muss der nach den Vorgaben des § 34 GEG berechnete Wärme- und Kälteenergiebedarf des Effizienzgebäudes bei einer EE-Klasse zu einem Mindestanteil von 65 % (bislang 55 %) durch die Nutzung erneuerbarer Energien und/oder, unvermeidbarer Abwärme und/oder aus Wärmerückgewinnung von Lüftungsanlagen gedeckt werden.“
Änderungen BEG-Richtlinie Wohngebäude
Gefördert werden die energetische Sanierung und der Ersterwerb nach Sanierung von Bestandsgebäuden, die nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme erstmals das energetische Niveau eines Effizienzhauses
erreichen (EE = Erneuerbare Energien; NH = Nachhaltigkeit).
Der Bereich Lüftungstechnik ist auch hier Bestandteil der Richtlinien-Anlage „Technische Mindestanforderungen“. Gemeint sind damit die technischen Anforderungen zu den einzelnen Fördertatbeständen, beispielsweise zu den Anforderungen an eine Effizienzgebäude-Stufe.
Änderungen gibt es auch hier im Abschnitt 3 Erneuerbare Energien-Klasse (EE-Klasse). Neu ist neben dem erhöhten Anteil von 65 Prozent auch für Wohngebäude die Möglichkeit der Wärmerückgewinnung aus Lüftungsanlagen zur Deckung des errechneten Wärme- und Kälteenergiebedarfs. In der Richtlinie heißt es: „Bei den Zusatzanforderungen an den Einsatz von Wärme aus erneuerbaren Energien muss der nach den Vorgaben des § 34 GEG berechnete Wärme- und Kälteenergiebedarf des Effizienzgebäudes bei einer EE-Klasse zu einem Mindestanteil von 65 % (bislang 55 %) durch die Nutzung erneuerbarer Energien und/oder unvermeidbarer Abwärme und/oder aus Wärmerückgewinnung von Lüftungsanlagen gedeckt werden. Alternativ kann das geförderte Gebäude an ein Wärmenetz angeschlossen werden.“
Neu hinzugekommen ist bei den Zusatzanforderungen folgender wichtiger Absatz: „Der Einsatz einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist in der EE-Klasse verpflichtend. Dabei können zentrale, dezentrale und Mischformen aus zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen zur Anwendung kommen. Die Lüftungsanlage muss in der Lage sein, die in DIN 1946-6 genannten planmäßigen Außenluftvolumenströme (Nennlüftung) für sämtliche Nutzungseinheiten beziehungsweise für das Gebäude sicherzustellen. Die Lüftungsanlage muss einreguliert werden. Beim EH-Denkmal ist der Einsatz einer Lüftungsanlage für das Erreichen der EE-Klasse dann nicht erforderlich, wenn der Einbau einer Lüftungsanlage aus technischen Gründen oder durch Auflagen des Denkmalschutzes nicht möglich ist.“
Änderungen BEG-Richtlinie Einzelmaßnahmen
Ziel der Richtlinie ist es, Investitionen in Einzelmaßnahmen anzureizen, mit denen die Energieeffizienz und der Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte in Gebäuden in Deutschland gesteigert und die CO₂-Emissionen des Gebäudesektors in Deutschland gesenkt werden. Das Erreichen einer (neuen) Effizienzhaus-Stufe durch die mit dieser Richtlinie geförderten Einzelmaßnahmen ist nicht erforderlich.
Gefördert wird der Einbau von Anlagentechnik in Bestandsgebäuden zur Erhöhung der Energieeffizienz des Gebäudes, dazu zählen der Einbau, Austausch oder die Optimierung raumlufttechnischer Anlagen inklusive Wärme-/Kälterückgewinnung.
Die Höhe des Zuschusses bemisst sich nach einem Prozentsatz der für die jeweilige Einzelmaßnahme einschließlich der erforderlichen Umfeldmaßnahmen insgesamt entstandenen förderfähigen Kosten. Raumlufttechnische Anlagen etc. fallen in dieser Richtlinie unter den Sammelbegriff „Anlagentechnik“.
Hierfür beträgt der Zuschuss-Satz nur noch 15 statt bislang 20 Prozent. Der Zuschuss-Satz erhöht sich um 5 Prozent, wenn ein individueller Sanierungsfahrplan zur Anwendung kommt. Auch zu dieser Richtlinie sind in der Anlage Technische Mindestanforderungen hinterlegt.
In Wohngebäuden werden von der BEG im Bereich Lüftung folgende Maßnahmen gefördert:
In Nichtwohngebäuden gibt es bei der Erstinastallation für folgende Maßnahmen eine Förderung:
Beim Austausch von Komponenten in bestehenden Lüftungsanlagen in Nichtwohngebäuden werden folgende Maßnahmen gefördert: