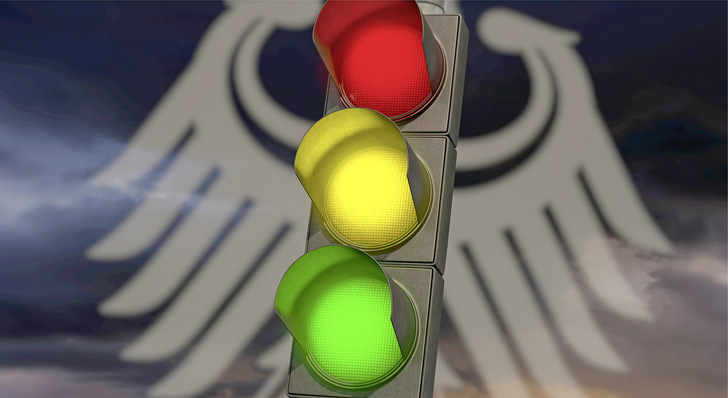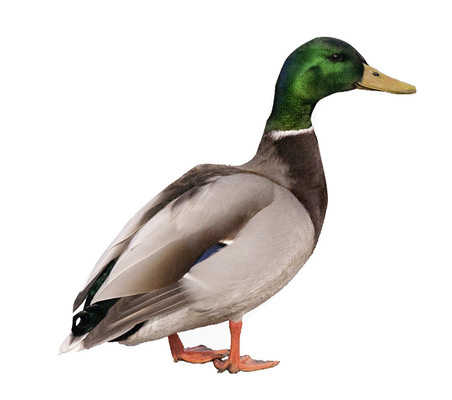Wie lähmend ein Koalitionsvertrag sein kann, hat sich in der letzten Übereinkunft dieser Art bei der Großen Koalition im Baubereich gezeigt. Ambitionierte Schritte in Bezug auf die Baustandards wurden bereits im Koalitionsvertrag durch die Festlegung „keine Verschärfung der Standards“ blockiert und damit ein Ordnungsrecht mit mehr Biss verhindert. Das ist diesmal anders. Durch die Bündelung vieler Zuständigkeiten im wieder etablierten Bauministerium ergeben sich neue Chancen. Darüber herrscht Erleichterung.
„Die Entscheidung, wieder ein eigenes Bauministerium zu schaffen, war richtig“, meint etwa DEN-Vorständin Marita Klempnow. „Sie gibt die Chance, deutliche Zeichen zu setzen und Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen aus der Vergangenheit zu korrigieren. Dazu ist die neue Hausherrin als durchsetzungsstarke Politikerin gefragt.“ Eine Ausweitung des Neubaus reiche nicht aus: „Mit einer jährlichen Quote von einem Prozent werden wir die Klimaziele mit absoluter Sicherheit nicht erreichen“, mahnt Klempnow.
Die Bundesarchitektenkammer bewertet die ordnungsrechtlichen energetischen Anforderungen, die Neuerungen bei der Förderung sowie die Aussagen zum nachhaltigen Bauen, zum Quartiersansatz und zur Innovationsklausel positiv.
Für die Bundesingenieurkammer geht der Koalitionsvertrag zwar in die richtige Richtung, vergibt aber wichtige Chancen. Angesichts der immensen Herausforderungen für den Planungs- und Bausektor seien vor allem finanzielle Verlässlichkeit, geeignete Rahmenbedingungen sowie passende nachhaltige Unterstützungs- und Förderangebote erforderlich. Dazu zählt der Verband die Stärkung der Freiberuflichkeit sowie die dringend notwendige Novellierung der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.
Einige Themen sind schon im Koalitionsvertrag konkret und ambitioniert formuliert. So ist das bereits von der Vorgängerregierung als Notbremse angekündigte Auslaufen der Neubauförderung für den KfW-Effizienzhausstandard 55 im Februar 2022 ein erstes Ausrufezeichen. Es wurde noch in der GroKo auf den Weg gebracht, als sich gezeigt hat, dass der Zuspruch zu diesem Neubauprogramm so enorm ist, dass die Mittel auszugehen drohen und für die dringenden Aufgaben im Gebäudebestand fehlen.
Im Prinzip sind sich viele Fachleute darin einig, dass die Motivation der Bauherren, ihre Gebäude zu sanieren, viel stärker in den Mittelpunkt rücken muss. Der Ausstieg aus der erst ein halbes Jahr vorher gestarteten Förderung der Effizenzhäuser 55 im Neubau geht aber vielen dann doch zu schnell. Vertreter der Energieberaterverbände DEN und GIH hatten beim Round-Table auf dem Fachforum Gebäudehülle des Gebäude-Energieberater im November 2021 gefordert, dass es eine längere Übergangszeit geben müsse, um Gebäude, bei denen bereits umfangreiche Vorarbeiten vollzogen wurden, noch umsetzen zu können. Die Immobilienunternehmen sehen das ähnlich.
Die Koalitionäre haben nun für 2022 ein Förderprogramm für den Wohnungsneubau angekündigt, das insbesondere die Treibhausgas-Emissionen pro Quadratmeter fokussieren soll. Das könnte eine teilweise Neuaufnahme der Förderung bedeuten, aber unter neuen Vorzeichen, auf die Planende, Beratende und Bauherren sich einstellen müssen. Andreas Ibel, Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), appellierte deshalb an die Bauministerin, die KfW-55-Förderung so lange fortzusetzen, bis das im Koalitionsvertrag vorgesehene Fördersystem eingeführt ist. „Die Übergangsfrist bis 31. Januar kommenden Jahres ist viel zu kurz“, erklärte auch er.
Insgsamt ist es für Planende und Beratende wichtig, bei der Förderpolitik weniger Hin und Her zu haben. Nach der Einführung der Bundesförderung für effiziente Gebäude im Sommer 2021 ist der Informationsbedarf nach wie vor enorm, vor allem durch laufende Anpassungen, über die sich Fachleute auf dem Laufenden halten müssen. Das ist nicht nur eine Frage guter Beratung, sondern auch der Haftung. Wenn man Fördertatbestände falsch einschätzt oder übersieht, kann das schnell teuer werden.
Eine wohl eher mittelfristige Baustelle ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Hier sieht das Koalitionspapier keine grundlegende Novelle vor, aber einige Änderungen. Wie diese konkret ausgestaltet werden, ist naturgemäß noch offen. So steht im Koalitionsvertrag, dass neue Heizungen ab 2025 mit 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. Das hört sich auf den ersten Blick technologieoffen an, hat aber wohl Konsequenzen für die Heizungen, die eingebaut werden können. Aus Sicht des Energieberaterverbands GIH wäre dann nur noch der Einbau bestimmter Hybridanlagen möglich.
Auch eine Kombination von Solarthermie mit Gas-Brennwert-Geräten beispielsweise schaffe in der Regel keinen Anteil von 65 Prozent Erneuerbaren. Das wäre auch das Aus für die im vergangenen Jahre eingeführte EE-Klasse, da die gesetzliche Anforderung dann ja höher läge, schätzt der GIH. Gerade in Mehrfamilienhäusern, deren Dachflächen im Vergleich zu den Wohnflächen geringer sind als bei Ein- oder Zweifamlienhäusern, gilt die 65-Prozent-Regel als besonders ambitioniert. Zumal es bei diesen Gebäuden schwieriger ist, einen größeren Anteil des Endenergiebedarfs mit Solarstrom zu decken.
Bei wesentlichen Ausbauten, Umbauten und Erweiterungen von Bestandsgebäuden müssen die auszutauschenden Teile ab 2024 dem Effizienzhausstandard 70 entsprechen. Geplant ist außerdem, die Neubau-Standards zum 1. Januar 2025 an den jetzigen Effizienzhausstandard 40 anzugleichen.
Eine Studie im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg hatte aber nicht nur kosmetische Korrekturen, sondern eine grundlegende und zügige Reform des Gebäudeenergiegesetzes gefordert (siehe auch GEB 07/2021). Wesentliche Punkte in dem Entwurf zu einem GEG 2.0 sind unter anderem
klimaneutralen Gebäudebestands,
Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker hat das Konzept zum ersten Treffen mit den Amtskolleginnen und Amtskollegen aus den anderen Bundesländern im Juli 2021 mitgenommen (siehe auch GEB 07/2021) und im GEB-Podcast auf eine positive Resonanz ihrer Amtskollegen verwiesen. Selbst wenn die Novelle auf Bundesebene ins Rollen kommt, dürfte es jedoch – ausgehend von den Erfahrungen der letzten Reform – viele Jahre dauern, bis diese in trockenen Tüchern ist.
Ressourcenpass macht graue Energie in Gebäuden transparent
Auch das Thema der Nachhaltigkeit im Baubereich haben die Ampelkoalitionäre an einigen Punkten adressiert. Sie schlagen einen digitalen Gebäuderessourcenpass vor, der auch den Einsatz grauer Energie sowie die Lebenszykluskosten verstärkt in den Blick nimmt. „Dass der Begriff ’Nachhaltig’ in seinen unterschiedlichen Formen mehr als einhundertmal in dem Dokument auftaucht, ist zumindest schon mal ein kleines Indiz dafür, dass es die künftige Bundesregierung ernst meint mit ihren Ambitionen“, urteilt Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.
Die angekündigte Stärkung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Gemeinwohlorientierung begrüßt sie ebenso wie die verstärkte Betrachtung von grauer Energie und Lebenszykluskosten. „Bei dem angedachten digitalen Gebäuderessourcenpass wäre es wünschenswert, diesen nicht nur einzuführen, sondern gleich Maximalwerte vorzugeben, um die Lenkungsfunktion des Instruments in Richtung Klimaschutz zu nutzen“, schreibt der Verband in seiner Stellungnahme zum Koalitionsvertrag. Neben der Erfassung regt der Verband auch ein verpflichtendes Emissions-Monitoring an. Das sei ein wichtiger Hebel für noch mehr zielführenden Klimaschutz.
Als weiterer Schritt zu Transparenz bei den Emissionen aus dem Gebäudesektor soll der Gebäudeenergieausweis vereinheitlicht und digitalisiert werden. Er hoffe, dass damit der Bedarfsausweis zum digitalen Standard werde, kommentiert der Energieberaterverband GIH. Eine Digitalisierung der Dokumente hätte zudem den Vorteil, dass zumindest mittelfristig ein besserer Überblick über den realen Zustand des Gebäudebestands besteht, zumindest für den Teil, der über einen aktuellen Energieausweis verfügt.
Sanierungsfahrplan soll für Eigentümergemeinschaften und beim Gebäudekauf kostenlos sein
Wohnungseigentümergemeinschaften sind nach wie vor zurückhaltend mit einer Sanierung. Um hier voranzukommen, sollen Sanierungsfahrpläne für diese Zielgruppe nichts mehr kosten. Aus Sicht des Verbands der Immobilienverwalter Deutschlands reicht das aber nicht: Es fehlten „im Koalitionsvertrag konkrete Zusagen, wonach bestehende Wohnungseigentümergemeinschaften bei energetischen Sanierungen unterstützt werden können“, erklärt der Verbandspräsident Wolfgang D. Heckeler. Die kostenlose Bereitstellung von Sanierungsfahrplänen hält er für nicht ausreichend.
Auch beim Kauf eines Gebäudes soll der Sanierungsfahrplan kostenlos sein. Faktisch würde das eine Förderquote von 100 Prozent bedeuten müssen. Der Kauf eines Gebäudes, beispielsweise von jungen Familien, gilt als wichtiger möglicher Sanierungsanlass – der Fahrplan soll helfen, die richtigen Schritte anzustoßen. Eine Vollförderung hätte aber möglicherweise den Nachteil, dass, was nichts kostet, in den Augen der Bezieher auch nichts wert ist. Insgesamt ist das Vorgehen bei den Sanierungsfahrplänen schon unter den jetzigen Bedingungen nicht unumstritten. Häufig geht es nicht um die beste Strategie, sondern um das Abgreifen der Förderboni.
Solarpflicht kommt zumindest für Gewerbebauten
Angekündigt ist außerdem, das Förderprogramm für serielles Bauen auszuweiten. Im Rahmen von Energiesprong sind dazu erste Projekte angelaufen. Sie sind derzeit jedoch noch auf wenige Bundesländer begrenzt und konzentrieren sich auf Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich bislang auch eher um Prototypen, in denen die Verfahren getestet werden, als um echte Massensanierungen großer Bestände.
Für Gewerbebauten sieht das Papier eine Solarpflicht vor. Bei privaten Neubauten soll sie zur Regel werden. Um den Ausbau der Photovoltaik zu beschleunigen, wollen die Koalitionäre die Netzanschlüsse und die Zertifizierung beschleunigen, Vergütungssätze anpassen sowie die Ausschreibungspflicht für große Dachanlagen und die Deckel prüfen. Ziel sei es auch, alle geeigneten Dachflächen zukünftig für Solarenergie zu nutzen. Einige Bundesländer sind da weiter und haben bereits eine Solardachpflicht beschlossen. Auch wird ein Abbau bürokratischer Hürden für private Bauherren versprochen. Die gibt es beim Mieterstrom zuhauf, auch bei Kleinvermietern.
Der Bundesverband Solarwirtschaft sieht im Koalitionsvertrag das Signal für die dringend nötige Entfesselung der Solarenergie. Das Vorhaben, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen und die Ausbauziele für Solartechnik deutlich zu erhöhen, hält er für folgerichtig. Der Verband begrüßt die Zielsetzung, dass die Wärmeversorgung bis 2030 zur Hälfte klimaneutral und Speicher als eigenständige Säule des Energiesystems rechtlich definiert werden sollen. Er unterstreicht die Notwendigkeit eines Sofortprogramms zur gewünschten Beschleunigung des Solar-Ausbaus. Eile sei dringend geboten, um die Versäumnisse und politischen Fehlentscheidungen der vergangenen Legislaturperiode zu korrigieren und zunehmend negativ wirkende Marktbremsen zu lösen.
Zur CO₂-Bepreisung heißt es im Koalitionsvertrag, man prüfe „einen schnellen Umstieg auf die Teilwarmmiete“ und wolle „zum 1. Juni 2022 ein Stufenmodell nach Gebäudeenergieklassen einführen.“ Sollte dies zeitlich nicht gelingen, werden die erhöhten Kosten durch den CO₂-Preis ab dem 1. Juni 2022 hälftig zwischen Vermieter und Mieterin bzw. Mieter geteilt. Die Modernisierungsumlage für energetische Maßnahmen, die eine dauerhafte Umlage der Sanierungskosten auf die Mieter erlaubt, soll nach Vorstellung der Politiker in diesem System aufgehen. Die Mietpreisbremse solle verlängert und verschärft werden.
Derzeit müssen Mieterinnen und Mieter den CO₂-Preis nach einem Beschluss aus dem Juni 2021 alleine tragen. Der sei in der jetzigen Ausprägung ohnehin zu niedrig, um Lenkungswirkung zu entfallen, argumentiert Martin Pehnt, Geschäftsführer des Ifeu im GEB-Podcast zum CO2-Preis. Bei Heizungen sehe man, dass man einen dreistelligen CO₂-Preis brauche, damit er sich entsprechend bemerkbar mache. „Wenn man heute beispielsweise Gas-Brennwertkessel mit einer Wärmepumpe vergleicht und dann so in Richtung 120 Euro pro Tonne CO₂ kommt, wäre Gleichstand erreicht. Das gilt allerdings, solange wir den Strompreis nicht günstiger machen. Wenn man da noch mal ansetzt, wäre schon ein niedrigerer CO₂-Preis ausreichend, um Kostengleichstand zu erreichen.“

Bild: Voyagerix - stock.adobe.com
Ostdeutsche SPD-Frau wird Bauministerin
Klara Geywitz ist 45 Jahre alt, in Potsdam geboren. Sie hat dort Politikwissenschaften studiert und in ihrer beruflichen Laufbahn unterschiedliche Positionen in der SPD Brandenburg innegehabt.
Im August 2020 wechselte Geywitz zum Landesrechnungshof in Brandenburg und leitete dort unter anderem die Prüfungen im Bereich Bauen, Wohnen und Verkehr. In ersten Äußerungen nach Amtsantritt hat sie angekündigt, das „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ mit der Immobilienwirtschaft fortzusetzen.
Die Ampel-Koalition plant laut Koalitionsvertrag den Neubau von jährlich 400 000 Wohnungen, davon 100 000 öffentlich gefördert. Deshalb will Geywitz gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Fachkräftemangel im Bauhandwerk angehen.

Bild: Werner Schüring
Ente oder Adler …
Auf dem Koalitionsvertrag der Ampelkoalition ist die Tinte getrocknet, von fast allen Seiten gab es Zustimmung für die Pläne von Rot-Grün-Gelb im Bereich Bauen und Sanieren. Doch das Lob ist teilweise vergiftet, weil es von vielen Seiten mit klaren Forderungen verbunden ist, verpackt in freundliche bis hin zu gönnerhaften Hinweisen, man stehe der noch unerfahrenen Ministerin gerne mit Rat und Tat zur Seite. Für Klara Geywitz steht nun die wichtigste Aufgabe an: das Umsortieren der Ressorts und die Bündelung der Kompetenzen im wieder eigenständigen Bauministerium. Klimaschutz soll hohe Priorität haben, darin sind sich die Koalitionäre einig. Dass es wieder ein Bauministerium gibt, ist ein gutes und notwendiges Zeichen, denn bislang hat der Gebäudesektor die Klimaziele nicht erreichen können. Um das zu ändern, müsste sich die zuständige Ministerin Klara Geywitz die Zuständigkeiten in ihr Haus zurückholen, die traditionell auf mehrere Ressorts im Innen-, Wirtschafts- und Umweltministerium verteilt waren. Und sie wird den Kampf um kluge Köpfe aus diesen Ministerien und deren Netzwerke führen müssen. Den Bereich der Gebäudesanierung hat sich Robert Habeck als Bundesminister für Wirtschaft und Energie bereits herausgeschnitten, er ist für Klimaschutz im Gebäudebereich zuständig. In welchem Umfang es Geywitz gelingt, sich neben dem grünen Alpha-Minister zu positionieren, entscheidet mit darüber, ob das Ministerium eine lahme Ente oder ein Adler mit kräftigen Schwingen wird. Für die Klimawende im Gebäudebereich wäre Fliegen die entschieden bessere Fortbewegungsart als Watscheln. Ob das mit einer Aufteilung der Zuständigkeiten in Bauen und Wohnen einerseits und Klimaschutz im Gebäudebereich andererseits funktioniert, darf bezweifelt werden. Das zeigen die Erfahrungen der großen Koalition, in der der schwarze Peter für fehlenden Schwung immer mal gerne den Ministerien der jeweils anderen Partei zugeschoben wurde.
Pia Grund-Ludwig