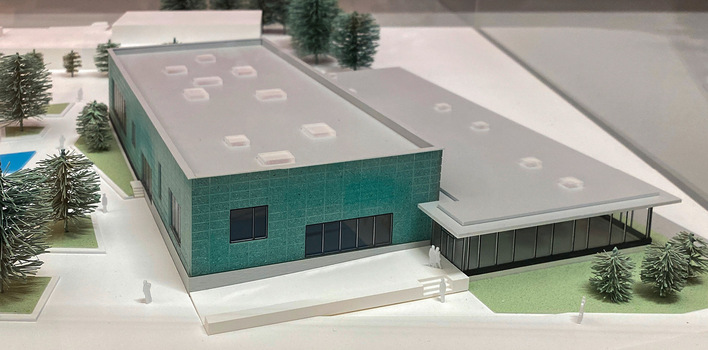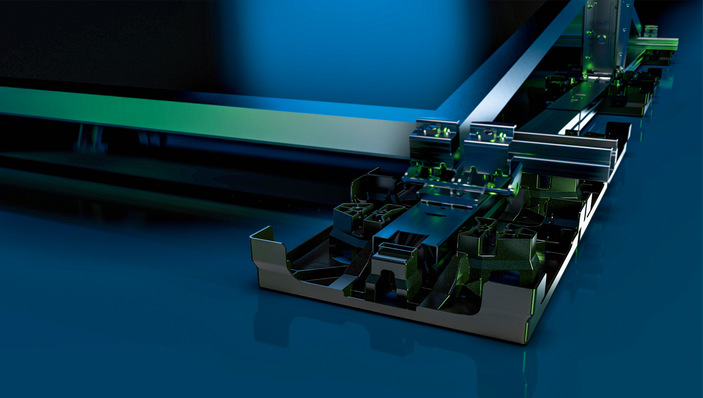Wie heizen wir in Zukunft unsere Häuser? Zum Jahresanfang traten mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und der dazugehörigen Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) aktualisierte Rahmenbedingungen in Kraft. Neue Tendenzen und neue Produkte unter den neuen Vorgaben gab es Ende April auf der Heizungsmesse IFH Intherm in Nürnberg zu sehen. Nahmen Gas-Brennwertgeräte vor zwei Jahren noch einen beträchtlichen Raum ein, schienen sie in diesem Jahr fast gänzlich verschwunden. Bei den Wärmeerzeugern dominierte die Wärmepumpe – selbst auf den Messeständen der meisten Holzkesselanbieter waren sie zu finden. Nicht wenige präsentierten sich mit ihnen als „Experten für grüne Wärme“.
Oftmals weisen ihre Wärmepumpen hohe Jahresarbeitszahlen auf. Durchgängig wird das mit geringem CO2-Ausstoß herzustellende Kältemittel R290 (Propan) eingesetzt, was der Bund mit fünf Prozent Bonusförderung honoriert. Marketingleiter Felix Gschwandtner von HDG Bavaria argumentiert für die neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen im Programm mit ihrem flüsterleisen Betrieb und dass ein „Silent Mode“ den Schall in der Nacht nochmal reduziere. Bei der Außeneinheit hat das Unternehmen auf den Einsatz von Plastik verzichtet und die Abdeckung bepflanzbar gestaltet.
„Für den Neubau und Niedertemperatur-Heizsysteme ist die Wärmepumpe einfach erste Wahl“, erklärt Herbert Schwarz, Vertriebsleiter von Hargassner, die neue Ausrichtung. Der Kesselproduzent aus Österreich hat deshalb vergangenes Jahr den Einstieg in den Wärmepumpenmarkt gewagt und den polnischen Hersteller HT Heiztechnik übernommen. Andere Holzheizungshersteller bieten schon seit einigen Jahren Wärmepumpen an: Brunner aus Niederbayern sowie Guntamatic, Herz, Solarfocus und Windhager aus Österreich.
Das Beispiel Windhager zeigt, dass der Aufbau einer neuen Produktsparte trotz vielversprechender Aussichten ein risikoreiches Vorhaben sein kann. Denn der Bau einer Wärmepumpen-Produktionshalle fiel zusammen mit dem durch einen Förderstopp hervorgerufenen Markteinbruch bei Biomassekesseln 2022 in Deutschland, was zur Insolvenz führte. Mit der Übernahme durch das Wasseraufbereitungsunternehmen BWT sind nun offenbar der Service und Fortbestand der Marke Windhager gesichert.
Firmen werben für Hybridsysteme
Mit den Wärmepumpen in ihrem Sortiment zielen die Holzkesselhersteller unter anderem darauf ab, Hybridsysteme und deren Vorteile anbieten zu können. „Während die Wärmepumpe in der Übergangszeit und an milden Wintertagen effektiv arbeitet, unterstützt der Biomassekessel bei extremen Außentemperaturen und garantiert beständig wohlige Wärme“, erklärt Schwarz. Bei Hargassner übernimmt die Wärmepumpe die Regelung der gesamten Anlage und entscheidet, welcher Wärmeerzeuger zu welchem Zeitpunkt als effizienterer und kostengünstigerer eingesetzt wird. „Durch das vollautomatische Zusammenspiel werden Effizienz und Lebensdauer beider Einheiten maximiert und gleichzeitig die Heizkosten minimiert“, nennt Schwarz als weiteren Vorteil der Kombination. Hargassner bietet vier Hybridsysteme mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe Airflow-M an.
Ökofen hat die Green-Mode-Steuerfunktion entwickelt, mit der die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden können, ob ihre Wärmepumpe maximal günstig oder maximal ökologisch arbeiten soll. Hierzu berücksichtigt sie Börsenstrompreise, was bei dynamischen Tarifen zum Tragen kommt, und länderspezifische CO2-Emissionen des aktuellen Strommix. Sie erkennt über diese Datenbank automatisch, wie ökologisch der von ihr verwendete Strommix ist und passt den Betrieb der Anlage an.
Um seine BWP-Wärmepumpen in hybride Systeme einbinden zu können, hat der Ofen- und Kesselbauer Brunner eine kleine Kontrolleinheit mit Touchdisplay zur Wandmontage entwickelt. Mit ihr lassen sich ein wassergeführter Ofen, ein Schichtladespeicher und eine Photovoltaikanlage integrieren. „Mithilfe der Kontrolleinheit kann das 65-Prozent-Erneuerbaren-Ziel nach dem Gebäudeenergiegesetz erfüllt oder eine maximale Autarkie angestrebt werden“, erläutert Heiztechnik-
Leiter Richard Wasmeier. Auch der Internetanschluss und damit die Einbindung der Heizungs-App auf Mobilgeräten seien möglich.
Stefanie Beckmann von der Firma Wodtke, Anbieter von Pellets- und Kaminöfen, hebt hervor, dass sich der wassergeführte Kaminofen Momo Water+ bestens für Hybridsysteme anbietet: „Von seinen acht Kilowatt Leistung leistet er etwa 70 Prozent „wasserseitig“. Durch die hohe Wasserleistung ist er hervorragend für die Kombination mit einer Wärmepumpe geeignet.“ In vielen Sanierungsfällen hält sie wassergeführte Pelletsöfen für eine ideale Ergänzung zur Wärmepumpe.

Bild: Christian Dany
Hersteller senken Feinstaubemissionen
Bei den Holzheizkesseln selbst gab es wenig wirkliche Neuheiten zu sehen, einige Weiterentwicklungen fanden sich aber doch darunter. So schafft der kleine Pelletskessel BPH 4/16 green von Brunner durch eine verbesserte Verbrennungstechnologie die Anforderung für den BEG-Emissionsminderungszuschlag von maximal 2,5 Milligramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft ohne zusätzliche Filtertechnik. „Möglich macht das die neue Brennwerttechnik, bei der die Abgase zurück in den Feuerraum geführt werden. Die Abgastemperaturen sinken auf 28 bis 38 Grad“, erklärt Wasmeier. Die Abgasrückführung habe nicht nur einen gesteigerten Wirkungsgrad des Pelletkessels zur Folge, sondern auch eine erheblich geringere Feinstaubbelastung.
Solarfocus zeigte seinen neuen Pelletskessel G Ecotop, der in drei Größen von 15 bis 24 Kilowatt erhältlich ist. In den Kessel mit der von dem Unternehmen bekannten Sturzbrandtechnik lässt sich optional ein elektrostatischer Staubabscheider integrieren. Mit 60 Zentimeter mal 65 Zentimeter Grundfläche lässt sich der Ecotop platzsparend aufstellen. Als besonderes Gimmick kann der Kunde bei der bedruckten Kesselfront ein Motiv auswählen.
Einen ganz wesentlichen Teil der Entwicklungsarbeit verwendeten Kesselhersteller außerdem darauf, die bei kleinen Pelletskesseln bereits bewährte Brennwerttechnik und elektrostatische Partikelabscheider auf größere Hackgut-, Pellets- und Scheitholzkessel zu übertragen. So präsentierten ETA, Hargassner und Herz neue Pelletskessel, in der für öffentliche Gebäude, das Kleingewerbe und Mehrfamilienhäuser relevanten Klasse bis 60 Kilowatt, die sie auf Wunsch mit integrierten Abscheidern und zum Teil mit Brennwerttechnik liefern.
Noch größer geht es bei HDG Bavaria und Ökofen. Durch die Integration eines Partikelabscheiders sind beim bayerischen Hersteller künftig neue Compact-Kesselmodelle mit 120 bis 150 Kilowatt lieferbar, die sowohl Hackgut als auch Pellets verfeuern können. Ökofen setzt seine in den Wärmetauscher des Kessels integrierte Brennwerttechnik und die besonders saubere Zero-Flame-Technologie auch bei der neuen Kesselreihe Condens XL mit 100 bis 130 Kilowatt Leistung ein. In dieser Größenklasse lohne sich die hocheffiziente Brennwerttechnik besonders, teilt das Unternehmen mit, denn mit 15 Prozent weniger Holzpelletsverbrauch spare ein Betreiber bis zu 2.000 Euro Brennstoffkosten im Jahr. Herz hat dagegen seinen Hackschnitzel-Brennwertkessel bis 40 Kilowatt aus dem Programm genommen, weil bei dem günstigen Brennstoff zu wenig Nachfrage nach der Hocheffizienz-Technologie bestand.
Heizomat konnte eine Verbesserung beim Partikelabscheider seiner Hackgutkessel umsetzen: Er sitzt nicht mehr auf der Kesseloberseite sondern seitlich zugängig am Ende des liegenden Rauchgaszuges. „Der Abscheider arbeitet dadurch bei einer höheren Temperatur, was den Abscheidegrad ansteigen lässt“, erklärt Vertriebsleiter Gerd Christ den Vorteil der neuen Positionierung. Ein definierter Abscheidegrad könne mit niedrigerer Spannung erreicht werden, was die Stromkosten senke.
Darüber hinaus ist beim fränkischen Holzheizungsspezialisten seit Januar 2024 eine App mit Cloud-Lösung verfügbar, mit der ein Betreiber unter anderem Daten zur Verfügung stellen kann, um eine Fernwartung zu ermöglichen. „Das Ziel ist, Wege einzusparen“, sagt Christ. In dem ein oder anderen Fall könne ein Problem gelöst werden, ohne dass der Werkskundendienst anrücken müsse. Außerdem könnten die Daten dem Installationsbetrieb übermittelt werden: „Das macht den Kundendienst schlagkräftiger.“ Die Betreiber von bestehenden Anlagen informiert Heizomat, dass die App auch nachgerüstet werden kann.

Bild: Christian Dany
Innovative Lösungen vorgestellt
Eine zwar nur für Nischenanwendungen gedachte, aber nichtsdestoweniger innovative Entwicklung stellte Guntamatic vor: Der Hackgutkessel Powerchip mit 75 oder 100 Kilowatt Leistung kann nebenbei Pflanzenkohle erzeugen. Hierfür hat das österreichische Unternehmen spezielle Komponenten und den Biochar-Betriebsmodus entwickelt. „Das Entscheidende ist die Mittelzone der Treppenrostfeuerung mit spezieller Pyrolysebrennkammer“, erklärt Entwickler Christoph Ebetshuber, „Mit geregelter Luftzuführung entsteht hier eine Pyrolysezone in sauerstoffarmer Umgebung bei 500 bis 600 Grad.“ Im letzten Drittel des Rostes werde die Pflanzenkohle mit rezirkuliertem Abgas gespült, was ihrer Qualität zugutekomme.
Ebetshuber zufolge können 15 bis 25 Prozent der trockenen Brennstoffmasse an Kohle erzeugt werden. Allerdings verringere sich im Biochar-Betrieb die Nennlast um bis zu 25 Prozent. Die vorrangig anvisierte Anwendung: Mit der Kohle die Gülle zur Bodenverbesserung und zum Humusaufbau aufzuwerten. „Wir wollen dem Landwirt einen Zusatznutzen bieten“, sagt der Konstrukteur. Durch die Einlagerung der Kohle im Boden werde das Kohlendioxid dauerhaft gebunden. Es entstehe eine Kohlenstoffsenke. Zwar könne die Kohle auch getrocknet werden. Sie sei jedoch nicht für Kunden gedacht, die damit handeln und CO2-Zertifikate verkaufen wollen.
Außerdem bringt Guntamatic demnächst eine einfache, aber effektive Lösung zur Nutzung von PV-Überschussstrom in einem Holzheizsystem auf den Markt. Über drehzahlgesteuerte Pumpen und Heizstäbe schichtet sie Wärme in einen Pufferspeicher. Das dazu notwendige Mild-Hybrid-Modul wird seitlich an den Biomassekessel angedockt. Es besteht aus einem 10-Liter-Wasserbehälter und – je nach Wärmebedarf und Größe der PV-Anlage – aus bis zu drei Elektroheizstäben. „Die Mild-Hybrid-Systeme werden vollständig über die Kesselsteuerung geregelt, die hierzu Daten zu Stromüberschuss, Temperatur, Ladezustand und Verbrauch nutzt“, erläutert Entwickler Martin Peinbauer.
Ein Heizstab ist stufenlos regelbar. Erreicht er die volle Leistung von drei Kilowatt, schalten sich automatisch der zweite und dritte Heizstab zu. Auf diese Weise lassen sich Betriebszeiten und Brennstoff einsparen. Warum Mild Hybrid? Der BEG-Klimageschwindigkeitsbonus erfordert ein zweites System für die Trinkwassererwärmung. Mit drei Heizstäben, also neun Kilowatt, kostet das System rund 2.500 Euro netto. Seit Juni ist es für den Pelletskessel Biostar mit Leistungen von 13 bis 33 Kilowatt lieferbar, weitere Kesseladaptionen folgen. Sie sehen: Als Partner für eine Holzheizung kommt nicht nur die Wärmepumpe infrage. Es kann auch eine Photovoltaikanlage sein.

Bild: Christian Dany
Guntamatic lässt sich der Überschussstrom einer Photovoltaikanlage für ein Holzheizungssystem nutzen.
Messesplitter
Staubfilter für gemauerte Kamine: Gesetzlicher Druck lässt die Entwicklung von elektrostatischen Feinstaubabscheidern voranschreiten. Ende 2024 läuft die Frist für Kamin- und Kachelöfen aus, die vor 2010 eingebaut wurden. Ab 2025 müssen sie die Grenzwerte der 2. Stufe der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung einhalten. Um auch bei einem gemauerten Schornstein einen teuren Ofentausch oder gar die Stilllegung einer Feuerstätte zu vermeiden, hat die Firma Oekosolve aus der Schweiz den Oekotube-Mauerwerk entwickelt. Der Feinstaubabscheider lässt sich im Innenbereich installieren – vorzugsweise im Dachboden, wo er für Reinigungsarbeiten gut zu erreichen ist. Dazu wird der Schornstein an einer Stelle, beispielsweise an einer vorhandenen Reinigungstür, geöffnet und ein Einbaurahmen eingemauert, an dem der Abscheider befestigt wird. Der Schornsteinfeger kann den Abscheider einfach aus dem Rahmen herausnehmen und wie gewohnt reinigen. Für den über einen Temperatursensor gesteuerten Betrieb ist lediglich ein Stromanschluss mit 230 Volt erforderlich. Der Oekotube-Mauerwerk ist bis 100 Kilowatt und für die Mehrfachbelegung mit mehreren Feuerstätten an einem Kamin bauaufsichtlich zugelassen.

Bild: Christian Dany
Baukasten für eine Brennstoffbox: Muss das Pelletslager ins Freie, kommt es auf Wetterschutz und eine ansprechende Gestaltung an. Diesen Ansprüchen soll eine Neuentwicklung der Firma Silotec gerecht werden. Wie Geschäftsführer Alexander Heiland erläutert, besteht die Silobox aus einer Stahl-Grundkonstruktion und Seitenteilen aus HPL- oder Metallplatten in individuellen Farben. Bei HPL-Platten handelt es sich um verpresste Laminate. Je nach gewünschter Höhe wird die Box mit der entsprechenden Zahl an Seitenteilen aus fünf verfügbaren Rasterstufen aufgebaut und mit einem Dachmodul abgerundet. Ein Lüftungskonzept schützt die Pellets vor Feuchtigkeit und Schimmel. „Dank Baukastensystem ist die Silobox in wenigen Stunden aufgebaut“, sagt Heiland.

Bild: Christian Dany
Brennstofflager für enge Räume: Mit dem System Variosilo präsentierte Fröling einen Gewebetank mit federbelasteter Aufhängung. Der Gewebetank hängt in einem Stahl- oder Holzrahmen. An der Unterseite des Tanks ist ein mit Zugfedern belasteter Rahmen befestigt. Mit fortschreitender Entnahme bewegt sich der Rahmen nach oben. Der Gewebetank bildet dadurch einen Kegel zur Mitte, wohin die Pellets schonend gelangen und abgesaugt werden. Der große Vorteil des Systems: Es bietet gegenüber einem herkömmlichen Gewebetank 30 Prozent mehr Lagervolumen bei gleicher Stellfläche.
Zuwachs bei der Maulwurf-Familie: Beim Maulwurf, einem über 35.000-mal verkauften Saug-Entnahmesystem der Firma Schellinger, gibt es jetzt das für mittelgroße Lagerräume bis 12 Quadratmeter Fläche entwickelte Modell G E2 . Es eignet sich für Lagerräume, die bis zu 15 Tonnen Pellets fassen, und für Kesselleistungen von 15 bis 50 Kilowatt. Der E2-Maulwurf verfügt über zwei Antriebswalzen und schließt damit die Lücke zwischen dem sich nach unten arbeitenden Maulwurf Classic für Gewebetanks und Klein-Lagerstätten und dem E3 mit drei Walzen für große Lager.

Bild: GHM
Mobil mit Pellets heizen: Die Firma Alois Müller präsentierte ihre
Mobile-Energy-Lösungen. Im Bauwesen, bei Festivals oder Outdoor-Events, in der Industrie oder in Notfallsituationen sind oft temporäre Wärme- oder Kühlsysteme gefragt. Hierfür bietet das Unternehmen mobile Heizzentralen sowohl zur Miete als auch zum Kauf an – darunter eine Pellets-Heizzentrale mit 60 Kilowatt Leistung auf einem Pkw-Anhänger sowie mobile Pellets-Heizcontainer mit 220 oder 330 Kilowatt Kesselleistung.