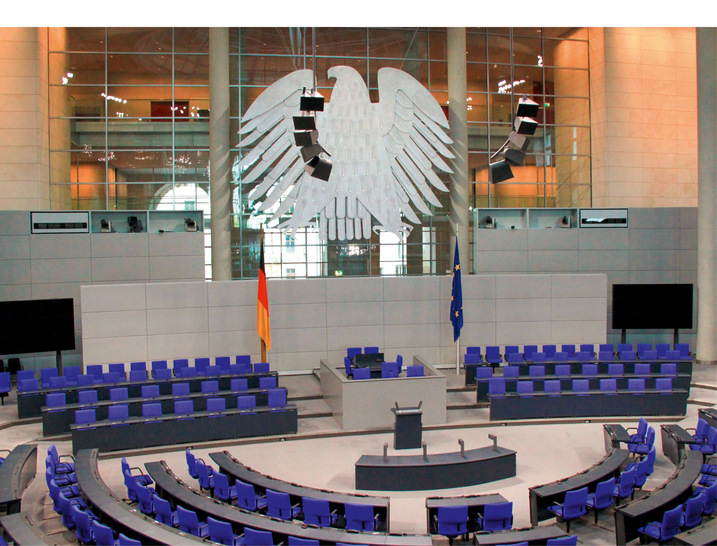Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Und dabei wird auch über die künftigen politischen Vorgaben in Sachen Energie und Bauen entschieden. Wenn man sich die Programme der einzelnen Parteien anschaut, stechen einige Themen besonders hervor, in denen es große Unterschiede gibt und die bei möglichen Koalitionsverhandlungen zu starken Reibungen führen dürften. Allen voran steht – wenig verwunderlich – das neue Gebäudeenergiegesetz. Aber auch die sogenannte Technologieoffenheit sowie die Haltung zur Kernenergie oder die CO₂-Bepreisung werden kontrovers diskutiert.
Energiepolitik
AfD
Die AfD bestreitet den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel. Der angebliche wissenschaftliche Konsens darüber sei politisch konstruiert, heißt es im Leitantrag der Bundesprogrammkommission. Sie kritisiert daher die „bevorzugte Behandlung erneuerbarer Energien“. Diese sollen sich ohne Subventionen bewähren und Vorrangeinspeisungen abgeschafft werden. Windkraftanlagen lehnt die AfD grundsätzlich ab. Kernenergie und Kohlekraft sollen wieder stärker genutzt werden. Außerdem fordert die Partei die Reparatur und Wiederinbetriebnahme der Nord-Stream-Pipelines.
Ein technologieoffener Ansatz soll Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit gewährleisten. Wasserstoff und Technologien wie Brennstoffzellen werden als zu teuer angesehen und daher abgelehnt. Die AfD fordert, Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen und plädiert für den Ausbau der Energieinfrastruktur. EEG-Umlage, CO2-Steuer und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sollen abgeschafft werden.
BSW
Das BSW befürwortet das Pariser Klimaabkommen, kritisiert jedoch eine überhastete Klimaneutralitätspolitik. Das Gebäudeenergiegesetz soll zurückgenommen werden. Der CO₂-Preis wird als nicht zielführend abgelehnt. Um Energiekosten zu senken, fordert die Partei langfristige Energieimporte zu niedrigen Preisen sowie Verhandlungen über die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen durch Nord Stream.
Die Energienetze sollen verstaatlicht und ausgebaut werden, um Kosten zu senken und die Versorgung zu stabilisieren. Erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden. Unter anderem wird ein Repowering bestehender Windkraftanlagen und die Förderung von Photovoltaik auf öffentlichen und privaten Gebäuden gefordert.
Bündnis 90/Die Grünen
Bündnis 90/Die Grünen setzen auf eine umfassende Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien. Bis 2030 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen stammen, bis 2035 soll Strom vollständig klimaneutral produziert werden. Ziel ist eine dezentrale Energieerzeugung ohne bürokratische Hürden für Bürger, Kommunen und Unternehmen. Energy Sharing soll günstigen Strom gemeinschaftlich nutzbar machen.
Um Schwankungen bei erneuerbaren Energien auszugleichen, setzt die Partei auf Netzausbau, Speicherlösungen und flexible, wasserstofffähige Kraftwerke. Wärmenetze sollen effizienter gestaltet und die Stromnetze weiter digitalisiert werden. Die Grünen setzen außerdem auf den Ausbau von Förderprogrammen und der Energieberatung. Fossile Energien und Atomkraft werden als Auslaufmodelle betrachtet.
CDU/CSU
CDU/CSU bekennen sich zu den Klimazielen bis 2045, setzen dabei aber auf marktwirtschaftliche Instrumente wie den Emissionshandel und eine CO₂-Kreislaufwirtschaft, um effizient Emissionen zu reduzieren. Auch sie plädieren für Technologieoffenheit und schließen dabei die Kernenergie ein. Im Fokus steht die Forschung zu Kernenergie der vierten und fünften Generation, Small Modular Reactors und Fusionskraftwerken.
CDU/CSU fordern ebenfalls die Abschaffung des Gebäudenenergiegesetzes. Gleichzeitig befürworten sie den Ausbau der erneuerbaren Energien. Alle Quellen wie Wind, Solar, Wasser, Geothermie und Bioenergie sollen genutzt werden. Kraft-Wärme-Kopplung soll intensiviert werden. Die beiden Parteien treten außerdem für die Förderung digitaler Energielösungen – wie zum Beispiel Smart Meter – ein.
Die Linke
Die Linke will mit einem schnellen Ausbau erneuerbarer Energien langfristig stabile und günstige Energiepreise ermöglichen. Im Mittelpunkt der Energiepolitik steht vor allem das Thema soziale Gerechtigkeit. So werden sozial gestaffelte Energiepreise mit günstigen Sockeltarifen für Strom und Heizung gefordert sowie die Einführung eines Energie-Soli für Reiche, um soziale Gerechtigkeit zu fördern. Haushalte mit niedrigem oder mittlerem Einkommen sollen rückwirkend ab dem 1. Januar 2025 jährlich pro Person ein Klimageld von 320 Euro als Direktzahlung erhalten, das an CO₂-Preise gekoppelt wird. Außerdem fordert die Partei eine Investitionsoffensive in energetische Sanierungen und in den Heizungstausch in Höhe von 25 Milliarden Euro pro Jahr. Beim Heizungstausch soll die Förderung für Zusatzkosten nach Einkommen gestaffelt werden. Auch die Linke lehnt das Gebäudeenergiegesetz ab.
FDP
Die FDP will das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 im deutschen Klimaschutzgesetz durch das europäische Ziel der Klimaneutralität bis 2050 ersetzen. Dabei setzt die Partei auf Technologieoffenheit und fordert den Ausbau von Carbon-Capture-Technologien. Außerdem ist das Ziel, einen einheitlichen europäischen Emissionshandel als Leitinstrument der Klimapolitik zu etablieren. Die CO₂-Bepreisung soll die Strom- und Energiesteuern ersetzen, um Anreize für den Einsatz erneuerbarer Energien zu schaffen. Die FDP will die Nutzung von Kernfusion und Kernkraftwerken ohne Subventionen ermöglichen. Die Wiederinbetriebnahme der vorhandenen Kernkraftwerke soll rechtlich ermöglicht werden. Das Gebäudenergiegesetz soll „vollständig auslaufen“.
SPD
Die SPD setzt auf erneuerbare Energien und den Umbau der Stromnetze, um bezahlbare und klimafreundliche Energie zu gewährleisten. Ein konsequenter Ausbau von Windkraft und Photovoltaik soll die Strompreise senken. Die Netzentgelte sollen auf drei Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Investitionen in klimafreundliche Technologien wie Wärmepumpen werden durch Steueranreize gefördert. Gleichzeitig setzt die SPD auf Wärmenetze. Diese für einen Stadtteil zu bauen, sei nicht nur solidarischer, sondern auch effizienter und kostengünstiger als einzelne Wärmepumpen in jedem Haus.
Wasserstoff soll als Schlüsselelement der Energiewende etabliert werden. Die SPD plant die Schaffung eines nationalen Wasserstoffnetzes und eine Wasserstoffreserve, um die Industrie zu unterstützen. Die Rückkehr zur Atomkraft ist für die SPD keine Alternative.
Baupolitik
AfD
Die AfD will das Baurecht reformieren. Es soll national geregelt bleiben, wobei das Prinzip des Bestandsschutzes betont wird. Bauvorschriften sollen weniger restriktiv sein, und der Neubau von Wohnhäusern soll erleichtert werden. Bei der Vergabe von Wohnbaugrundstücken und Wohnraum will die AfD Einheimische bevorzugen. Der soziale Wohnungsbau wird als ineffizient angesehen.
BSW
Das BSW will öffentliche Investitionen in den Bau neuer Wohnungen und die Renovierung bestehender Gebäude intensivieren. Gleichzeitig betont das Bündnis die Notwendigkeit fairer Bedingungen für Hauseigentümer und Mieter. Kommunen sollen mehr finanzielle Mittel und Entscheidungsfreiheit erhalten, um Investitionen in Infrastruktur und Wohnungsbau flexibel an die lokalen Bedürfnisse anzupassen.
Bündnis 90/Die Grünen
Beim Thema Bauen legen Bündnis 90/Die Grünen den Fokus auf die Nutzung bestehender Potenziale – wie der Umwandlung von Büroflächen zu Wohnraum, Aufstockungen von Gebäuden und der Reaktivierung leerstehender Immobilien. Dafür sollen das Baurecht vereinfacht und Verfahren digitalisiert werden. Außerdem strebt die Partei eine Reduktion baulicher Standards an, um kosteneffiziente Bauprozesse zu ermöglichen. Im sozialen Wohnungsbau fordern die Grünen höhere Fördermittel und eine Stärkung gemeinnütziger und genossenschaftlicher Wohnbauprojekte. Sie setzen außerdem auf die Kreislaufwirtschaft beim Bauen. Sanierungen sollen einfacher und stärker gefördert werden, auch mit taxonomiekonformen Anrechnungen für klimafreundliche Projekte.
CDU/CSU
Eines der Themen, das bei der Union im Mittelpunkt steht, ist die Entbürokratisierung. Um Bauprojekte zu beschleunigen, sollen Bauordnungen und Raumplanungsregelungen vereinfacht werden. Mit dem Gebäudetyp E sollen die Voraussetzungen für kostengünstigeres Bauen geschaffen werden. Ziel ist es außerdem, energetische Sanierungen durch steuerliche Anreize zu fördern. Dafür wollen CDU/CSU entsprechende Kosten von der Erbschaft- und Schenkungsteuer abzugsfähig machen. Der bestehenden Energieeffizienzstandard EH55 für Neubauten soll beibehalten und wieder förderfähig werden.
Die Linke
Auch in der Baupolitik fokussiert sich die Linke auf soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung. Neubauten sollen energieeffizient und bezahlbar gestaltet werden. Öffentliche Förderung wird auf gemeinnützigen Wohnungsbau konzentriert. Jährlich sollen 20 Milliarden Euro in entsprechenden Wohnraum investiert werden – mit dem Ziel, 30 Prozent des Wohnungsmarktes gemeinnützig zu gestalten.
FDP
Auch die FDP setzt auf den Gebäudetyp E. Sie sieht ihn als Blaupause für eine Vereinfachung des Baurechts. Überflüssige Bauauflagen sollen abgebaut und auf sinnvolle Mindeststandards begrenzt werden. Außerdem will die Partei mit einheitlichen Anforderungen und digitalen Genehmigungsprozessen das serielle Bauen fördern. Digitale Gebäudemodelle sollen durch einheitliche Standards und Schnittstellen zum neuen Planungsstandard werden. Bei der Stadtplanung will die FDP digitale Technologien und Daten nutzen, um das Leben der Bürger zu verbessern und Städte zu Smart Cities weiterzuentwickeln. Überflüssige Umweltgutachten sollen abgeschafft werden.
SPD
Ein Ziel der SPD ist es laut Wahlprogramm, den Bürokratieabbau fortzusetzen und der Bauverwaltung einen Digitalisierungsschub zu geben. Dies soll dazu führen, Baukosten zu senken und Verfahren zu beschleunigen. Außerdem sieht die Partei im seriellen und modularen Bauen große Potenziale. Vereinfachte Baustandards wie der Gebäudetyp E müssten weiterentwickelt werden. Förderprogramme im Baubereich sollen zukünftig zu festen Förderkonditionen für die Dauer der Legislaturperiode verlässlich angeboten werden.■
Von der Partei Freie Wähler Bundesvereinigung lag bis Redaktionsschluss kein Wahlprogramm vor.
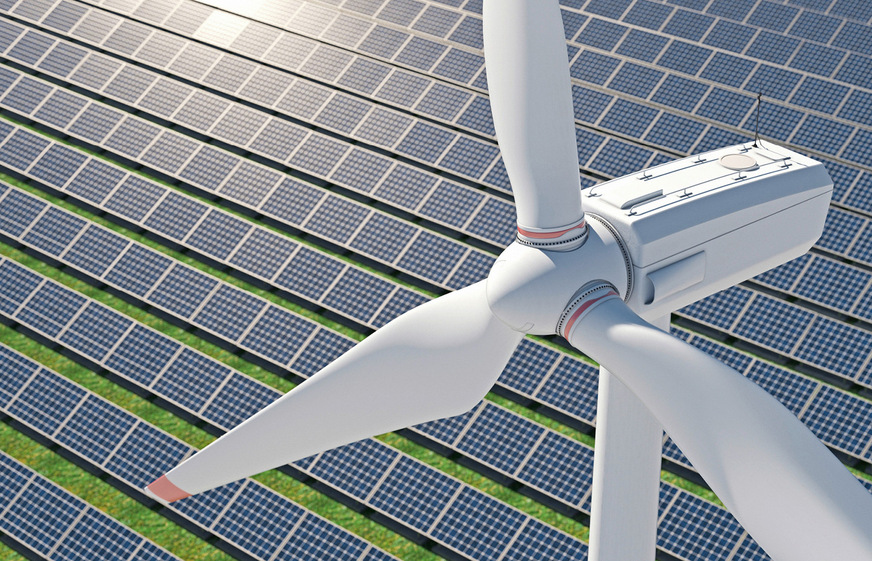
Bild: Negro Elkha - stock.adobe.com

Bild: fotomek - stoch.adobe.com
Die Quellen
Dieser Artikel basiert auf folgenden Dokumenten: