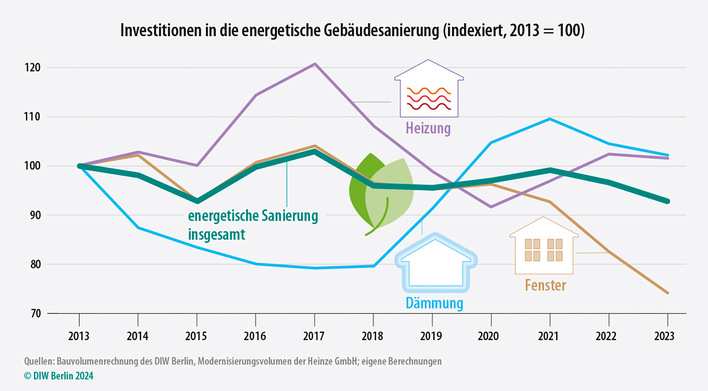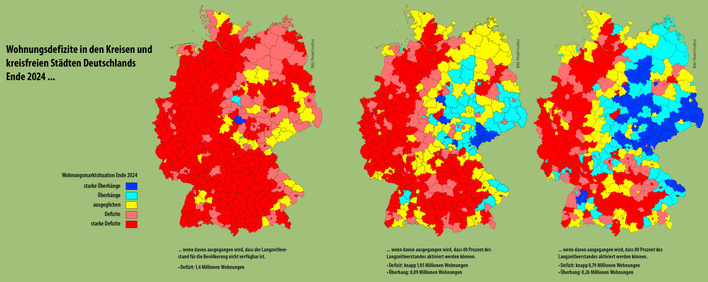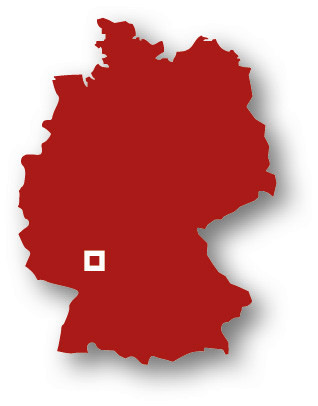
Zu den drei Säulen der Nachhaltigkeit gehören Ökologie, Ökonomie und Soziales. Darüber hinaus spielen Ästhetik und Innovation eine große Rolle, um Gebäude nachhaltig umzugestalten. Erfüllen Gebäude diese Kriterien besonders umfänglich, prämiert sie die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) seit 2013 mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur. In Kooperation mit der Stiftung deutscher Nachhaltigkeitspreis verlieh Geschäftsführerin Christine Lemaitre den Preis beim 16. Deutschen Nachhaltigkeitstag am 24. November in Düsseldorf. Der Preisträger: die U-förmige Lagerhalle in Mannheim, die zur Bundesgartenschau 2023 umgestaltet wurde.
Nichtwohngebäude werden immer seltener abgerissen
Mit alten Lagerhallen tun sich Städteplanerinnen und Städteplaner schwer. Sie betrachten die Gebäude eher als platzfressende Abrisskandidaten denn als Objekte, die es sich zu sanieren lohnt. Insgesamt setzt bei Nichtwohngebäuden in Deutschland aber ein Umdenken ein: Wurden laut Zahlen des Statistischen Bundesamts Ende der 1990er Jahre noch jährlich über 20.000 Nichtwohngebäude abgerissen, waren es im vergangenen Jahr weniger als 8.000 Gebäuden.
Der häufigste Grund für den Abriss sind Nutzungsänderungen. Da Nichtwohngebäude häufig für eine spezifische Nutzung ausgelegt sind, ist eine andere Verwendung schwer möglich. Sie werden auch häufig abgerissen, um neue Gebäude zu errichten und neue Freiflächen zu schaffen. Beim Abriss geht jedoch graue Energie verloren, die bei Bau, Herstellung und Transport verbraucht worden ist.
Zirkularität in Bauweise und Nutzung umgesetzt
In Mannheim folgte man dem Trend gegen den Abriss. Das Architekturbüro Hütten & Paläste aus Berlin erneuerte für die Bundesgartenschau 2023 ein ehemaliges Distributionszentrum der amerikanischen Streitkräfte. Das U-förmige Bauwerk hat eine Länge von 700 Metern und eine Bruttogeschossfläche von 20.000 Quadratmetern. Für Ausstellungen der Bundesgartenschau bot der Bau genügend Fläche und vermied gleichzeitig temporäre Neubauten. Zukünftig bietet die Lagerhalle einen Platz für Kultur und Freizeit.
Hauptgestaltungsmerkmal der Umnutzung ist der Wechsel von geschlossenen und teilweise offenen Hallenteilen, in denen nur noch das Tragwerk wie ein Pergolenraster den öffentlichen Freiraum überspannt. Neben den Teilöffnungen der Hallen entstanden neue Wegeverbindungen, die eine klimaökologisch wichtige Kaltluftschneise Mannheims beachten. Sie soll der Überhitzung der Innenstadt im Sommer entgegenwirken. Entsiegelte Flächen sowie begrünte und bepflanzte Hallenteile leisten zudem einen positiven Beitrag zur Klimaanpassung und zur Stärkung der Biodiversität. Vorhandene Bauteile verwendete man über den erhaltenen Bestand hinaus teilweise unverändert wieder oder setzte sie ergänzend zur Ertüchtigung von anderen Bauteilen ein. Alle Umbauten wurden weitestgehend mit lösbar verbundenen Baumaterialien ausgeführt.
Die Zirkularität ergibt sich darüber hinaus nicht nur durch die Bauweise, sondern auch die Nutzungsweise. Durch Zerlegen und Wiederaufbau können Bauteile direkt vor Ort dazu verwendet werden, neue Raumzusammenhänge für spätere, bisher noch unbekannte Nutzungen herzustellen. Die Jury des deutschen Nachhaltigkeitspreises begeisterte daher besonders, dass die einst monofunktionale Lagerhalle in ein multifunktionales, nachhaltig veränderbares Gebäude umgewandelt und fit für weitere Lebenszyklen gemacht wurde.
Klimakonzepte stehen bei Finalisten im Vordergrund
Ins Finale des Nachhaltigkeitspreises war auch die Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins in München-Schwabing gekommen. Den Betonkern des viergeschossigen Altbaus mit Tiefgarage aus den 1970er Jahren erhielt das Büro Element A Architekten beinahe vollständig. Die Aufstockung um zwei Geschosse erfolgte inklusive der Kernzone mit Aufzug und Treppenhaus in Holz-Massivbauweise. Außerdem verfügt das Gebäude nun über ein Klimakonzept in Lowtech-Bauweise, bei dem Lüftungselemente nicht wie sonst über dem Fenster montiert, sondern bodennah in den Brüstungsaufbau integriert wurden. Hinzu kommen zwei zentrale Luftschächte für die Nachströmung und die sommerliche Nachtauskühlung.
Ebenfalls die Finalrunde hatte die Revitalisierung des Congress Center Hamburg erreicht. Die Arbeitsgemeinschaft aus agn Leusmann und Tim Hupe Architekten erweiterte das 50 Jahre alte Kongresszentrum mit einer neuen Eingangshalle und entwickelten ein Klimakonzept. Die bedarfsgerechte Erweiterung steigert langfristig die Zahl der möglichen Kongressteilnehmenden innerhalb des terrassenförmig angelegten Betonflachdachbaus. Zur natürlichen Beschattung beitragende vertikale Linsen an der Fassade und die Steuerung des Wärmebedarfs optimieren die klimatischen Bedingungen. fk