Seit 2007 setzt sich die DGNB für eine Transformation des Bauwesens ein, hin zu mehr Ressourcenschonung, Klimaschutz sowie zur Wahrnehmung sozialer Verantwortung. Sie zertifiziert in Deutschland und global nach ihren Maßstäben nachhaltige Projekte. Planende, die zum Beispiel eine entsprechende Zertifizierung anstreben, können in einer eigenen Datenbank, dem DGNB-Navigator [1], anhand der Herstellerangaben nach eventuell passenden Bauprodukten suchen. Wie der Navigator funktioniert, was er bietet und was nicht, und welche Entwicklungen in der Branche Anlass zur Hoffnung geben, das verrät Johannes Kreißig, einer der beiden geschäftsführenden Vorstände der DGNB.
Was findet man an Produkten im DGNB-Navigator, wie sehen die Auswahlkriterien aus? Und wie ist die Bauprodukteplattform aufgebaut?
Wichtig vorab: Weder bescheinigen wir durch die DGNB die Nachhaltigkeit von Bauprodukten als solchen, noch zertifizieren wir sie. Sie sind allein über ihre Performance im Kontext der Anwendung im spezifischen Projekt bewertbar – Sinnhaftigkeit des Einsatzes, Aufwand, Nutzen, Wirkung.
In der Datenbank werden die Produkte samt der dazugehörigen Kennwerte erfasst. Zunächst gibt es keine inhaltlichen Hürden. Die Kennwerte und Herstellerangaben werden jedoch vor Veröffentlichung auf Plausibilität geprüft, indem beispielsweise gesetzlich geregelte Sicherheitsdatenblätter, technische Merkblätter, Emissionsprüfzeugnisse mit Bezug auf Normung und Gesetze abgefragt werden. So ist Greenwashing ausgeschlossen.
Der Navigator bietet zwei Bereiche: Im öffentlichen „Schaufenster“ sind Produkte und Hersteller für jeden auffindbar. Der zweite Bereich ist ausschließlich DGNB-Auditorinnen und -Auditoren vorbehalten für die Dokumentation von Projekten. Hier sind neben den öffentlich einsehbaren Produkten alle weiteren Produkte sichtbar, die im Kontext von DGNB-zertifizierten Projekten von den Auditierenden erfasst wurden. Im Auditorenbereich geschieht der Check der Daten nicht unmittelbar nach dem Einstellen, sondern erst im Zuge der Prüfung des zur Zertifizierung eingereichten Projektes, so dass dieser Bereich Schritt für Schritt wächst.
Was unterscheidet den DGNB-Navigator von der Datenbank Ökobaudat, was vom Baustoffinfosystem Wecobis?
Die Ökobaudat ist eine generische und produktspezifische Sammlung von Ökobilanzdaten und Umweltproduktdeklarationen in Form von EPDs und bildet die Referenzdatenbank zur Erstellung von Ökobilanzen bei der DGNB. So gesehen ist sie mit dem DGNB-System verbunden. Wecobis bietet Informationen und Hintergrundwissen zu Baustoffen allgemein, wie Materialität, Einsatzzwecke, teilweise auch Kennwerte. Der DGNB-Navigator zeigt dagegen die produktspezifischen Kennwerte, die die deklarierenden Hersteller angeben.
Einige der Produkte tragen das DGNB-Navigator-Label. Welche Voraussetzungen muss ein Hersteller erfüllen, um es zu erhalten?
Das Navigator-Label zeigt an, dass alle für die DGNB-Zertifizierung relevanten Nachhaltigkeitsinformationen vorhanden sind. Sprich, dass das Produkt vollständig dokumentiert ist.
Abgesehen von den Daten im Navigator – an welchen Siegeln, Labels oder Gütezeichen können sich Planende auf der Suche nach nachhaltigen Produkten orientieren?
Bei der DGNB werden Labels nicht nur empfohlen, sondern sie sind die Grundlage für die Dokumentation von Bauprodukten im DGNB-System. Sie sind insbesondere wichtig für die Themen Schad- und Risikostoffe, Lieferkette und die Recyclingfreundlichkeit, also die Circular Economy. Aufgeführt werden sie in der DGNB-Labelanerkennung [2]. Das FSC-Label für nachhaltige Forstwirtschaft kann beispielsweise als Nachweis einer nachhaltigen Lieferkette eingesetzt werden. Das Eco-Institut-Label kann für die Einstufung des Emissionsverhaltens eines Produktes angewandt werden. Darüber hinaus sind im DGNB-Kriterium Schad- und Risikostoffe einzelne Labels als Nachweis für bestimmte Anforderungen genannt, wie der Blaue Engel für Innenwandfarben – um sicherzustellen, was alles nicht drin sein darf. In der Regel wird mit solchen Siegeln die Nachweispflicht schneller erfüllt, als wenn die Einhaltung sämtlicher Anforderungen einzeln per Nachweis zu belegen sind.
Eine der Dimensionen der Nachhaltigkeit ist neben Ökologie und Ökonomie der Aspekt der Menschenrechte und insbesondere der arbeitnehmerrechtlichen Situation in Bezug auf die Vorkette. Einen schlechten Ruf haben in dieser Hinsicht Natursteine aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Wie ist es in diesem Bereich derzeit um die Transparenz bei Rohstoffgewinnung und -aufbereitung bestellt?
Das ist ein wichtiger Punkt. Hier gibt es Zertifikate wie etwa Fair Stone, wo genau diese Aspekte geprüft und die Produktionsstätten auditiert werden. Auf europäischer Ebene gilt zudem seit Ende 2023 ein eigenes Lieferkettengesetz, es soll im Umgang mit diesen Themen mehr Rechtssicherheit schaffen. Für die deutschen Verarbeiter, Importeure und so weiter bringt das strengere gesetzliche Pflichten mit sich.
Selbst ab Werk zertifiziert nachhaltige Bauprodukte können je nach Transportweg und Einsatz auf der Baustelle die Nachhaltigkeit eines Projektes mindern. Wie geht das Bewertungssystem mit dieser Problematik um? Und umgekehrt können ressourcen- und CO2-intensiv hergestellte, aber dauerhafte Bauprodukte die Nutzungsphase eines Gebäudes verlängern. Wie wird diese Tatsache berücksichtigt?
In der neuesten Version der DGNB-Kriterien haben wir 2023 einen Bonus für kurze Transportwege im Kriterium Klimaschutz adressiert. Die produktspezifische Nutzungsdauer fließt ebenfalls in dessen Berechnung mit ein, der Vorteil langlebiger Bauprodukte ist Teil der Bewertung. Im Bereich Bodenbelag in einem Gewerbeobjekt schneidet dann beispielsweise ein Parkettboden mit langer Nutzungsdauer besser ab als ein Teppichboden, der alle fünf bis zehn Jahre ausgetauscht werden muss.
Nach allgemeiner Wahrnehmung hat gerade Beton ein Nachhaltigkeitsproblem, da bei der Produktion CO2-Emissionen nicht nur durch den Verbrauch fossiler Energie entstehen, sondern in hohem Maße durch das Brennen des Kalksteins im Zuge der Zementherstellung. Welche Ansätze gibt es, Beton dennoch nachhaltiger zu machen, ebenso Kalksandstein, Porenbeton und Stahl?
In der DGNB-Publikation „Bauprodukte im Blick der Nachhaltigkeit“ [3] findet man auf Seite 31 vertiefende Informationen zu Beton und derzeitigen Alternativen. Ergänzend zu diesen wird langfristig Carbon Capture Use and Storage (CCUS) zum Einsatz kommen müssen. Beispielsweise kann das abgeschiedene CO2 aus dem Zementwerk in anderen Industrien, wie der Chemie- oder Getränkeindustrie, verwendet werden.
Kalksandstein und Porenbeton brauchen ebenfalls gebrannte Bindemittel: gebrannten Kalk beim Kalksandstein, gebrannten Kalk und Zement beim Porenbeton. In einem Behälter werden sie zusätzlich unter Druck mit Dampf gehärtet. Die Dekarbonisierung muss im Werk erfolgen, über CCS, die Abwärme des Druckbehälters kann im Betrieb genutzt werden.
Dafür müssen aber zunächst geeignete Anlagen erstellt werden. Technisch ist das möglich, der Markt kann aber noch nicht in ausreichendem Maße bedient werden. In Schweden wird aktuell eine mit grünem Wasserstoff betriebene Stahlproduktion nach dem Direktreduktionsverfahren aufgebaut, die ab 2026 nahezu klimaneutralen Stahl herstellen soll. Das ist ein Anfang. Sie wird nicht ganz Europa versorgen können, aber Produktionskapazitäten entstehen.
Ihre Publikation „Wegweiser Klimapositiver Gebäudebestand“ nennt als einen wichtigen Beitrag die Verwendung klimapositiver Bauprodukte. Worum genau handelt es sich? Als vielversprechende Innovationen werden in diesem Zusammenhang außerdem in den Medien Kunststoffe genannt, die auf der Basis von abgeschiedenem CO2 hergestellt werden. Sind solche Produkte bereits erhältlich?
Wenn ich mit nachwachsenden Rohstoffen arbeite, habe ich im Bauprodukt gebundenes CO2. Das ist bewusst als ein Lösungsweg aufgeführt. Die Produktion mittels abgeschiedenem CO2 ist tatsächlich eine Option, wenngleich eine energieintensive. Heutzutage steht es aber noch nicht zur Verfügung, daher ist das aktuell noch keine Alternative.
Was generell die Einbeziehung nachwachsender Rohstoffe betrifft, kann jedoch die gesamte Kunststoffchemieindustrie damit adressiert werden. So läuft bei der BASF ein aufwendiges Programm, um erneuerbare Ressourcen in ihre Rohstoffversorgung zu integrieren. Wir sehen, dass sich hier praktisch alle auf den Weg machen. Die Entwicklung braucht aber viel Zeit.
Zum DGNB-Gebäuderessourcenpass: Wie ist aktuell das Echo? Welche weiteren Bewertungssysteme in Sachen Zirkularität sind mit ihm kompatibel?
Insbesondere in Fachkreisen ist das Interesse sehr groß. Die Experten von Concular, Madaster, EPEA und andere haben bei der Erarbeitung unseres Gebäuderessourcenpasses mitgearbeitet. Infolgedessen sind die Systeme aufeinander abgestimmt.
Kann man allgemein eine Entwicklung hin zu mehr Transparenz, zu nachhaltigerer Produktion feststellen? Einladung zum Selbstlob: Übt die DGNB hier einen „erzieherischen“ Einfluss auf die Industrie aus?
Ja, ganz klar. Transparenz ist immer eine Voraussetzung für besser informierte Entscheidungen. Die DGNB-Kriterien zu Schad- und Risikostoffen haben ebenso wie die Transparenz im DNGB-Navigator bereits in vielen Bereichen dazu geführt, dass Produkte optimiert wurden. Wo es früher hieß, das sei technisch nicht möglich, gibt es die gefragten Produkte heute. So etwas würde in einem rein ökonomischen Markt nicht passieren.
Vor zehn Jahren war die Antwort der Industrie in Sachen Dekarbonisierung: Es geht in den meisten Bereichen nicht. Heute haben alle relevanten Sektoren eine derartige Strategie und die einzelnen Unternehmen klare Fahrpläne zur Umsetzung. Ausgehend von der Finanzwirtschaft werden überdies im Zuge der EU-Taxonomie [4] Themen wie Klimaschutz, Klimaanpassung, aber auch Schad- und Risikostoffe über das Reporting in die komplette Lieferkette mit reingenommen. Das heißt: Ohne sich um diese Themen zu kümmern, kann ein Unternehmen langfristig nicht existieren.
Die Fragen stellte Alexander Borchert
Quellen
[1] https://www.dgnb-navigator.de/
[2] https://t1p.de/GEB240130
[3] https://t1p.de/GEB240131
[4] https://t1p.de/GEB240132
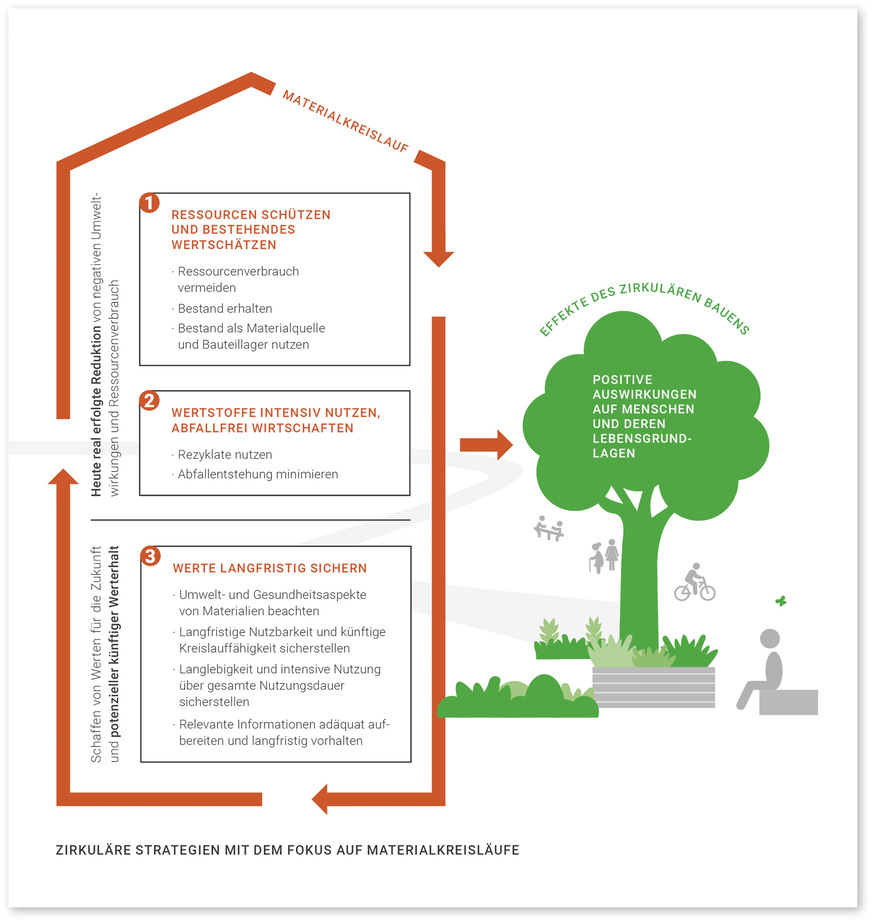
Bild: DGNB
GEB Dossier
Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Wohngesund bauen mit -Beiträgen und News aus dem GEB:
www.geb-info.de/-wohngesund-bauen







