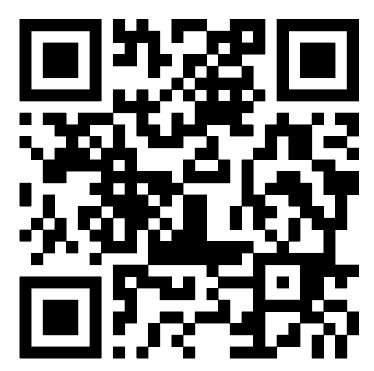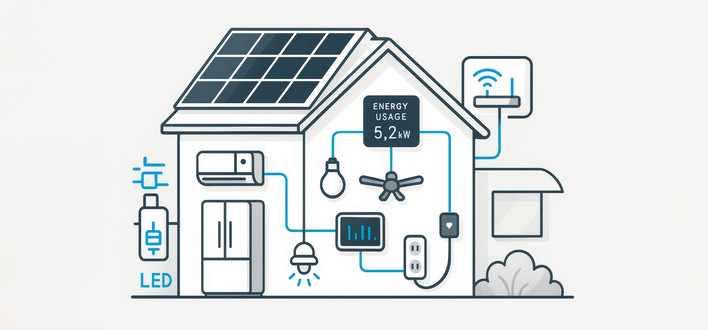Die Zahlen des Monats auf Seite sechs dieser Ausgabe haben gezeigt: Das Recycling von Baustoffen spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, den Bau umweltfreundlicher zu gestalten. Verwendete Rohstoffe nicht einfach zu entsorgen, sondern sie clever wiederzuverwenden, erscheint ebenso einleuchtend. Bei dem sogenannten Urban Mining wird diese Idee verfolgt. Die Stadt und ihre Bauwerke verhalten sich nicht nur als Verbraucher, sondern gleichzeitig als Produzenten von Baurohstoffen. Das Ziel hinter dieser Idee ist die Kreislaufwirtschaft. Hierbei werden intelligente Verwendungsweisen für Recycling-Baustoffe gesucht.
Rohstoffe ganzheitlich denken
Urban Mining verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem für langlebige Güter eine Verwendung nach der eigentlichen Benutzung mitgedacht wird. Laut Umweltbundesamt bezieht Urban Mining den Gesamtbestand an langlebigen Gütern ein, um möglichst früh künftige Stoffströme prognostizieren zu können und bestmögliche Verwertungswege abzuleiten, noch bevor die Materialien als Abfall anfallen.
Je mehr Wissen um die gebundenen Materialien vorhanden ist und die Zeiträume, wann diese wieder aus dem Bestand freigesetzt werden, umso besser können sich die beteiligten Akteure auf sich neu entwickelnde Abfallströme und deren Verwertung einstellen. Die urbanen Ressourcen sollen somit nutzbar gemacht werden.
Die Verwertungsmöglichkeiten von Recycling-Baustoffen hängen von ihren bautechnischen und umweltrelevanten Eigenschaften sowie ihrer stofflichen Zusammensetzung ab. Neben den Ausgangsqualitäten werden die Eigenschaften maßgeblich von der Verfahrensweise beim Abbruch, von der Getrennthaltung der Fraktionen und von der eingesetzten Aufbereitungstechnik bestimmt. Hier sind Politik und Unternehmen gleichermaßen gefordert. Für einen schnellstmöglichen Wandel müssen sie Hand in Hand arbeiten, um Entwicklung zu unterstützen. Politische Vorgaben sollen die Einführung von Recycling-Baustoffen erleichtern, wohingegen Unternehmen an intelligenten Verwendungsweisen der wiederverwendbaren Stoffe forschen.
Politik setzt Anreize für Kreislaufwirtschaft
Die Verwertung der in Deutschland anfallenden mineralischen Bau- und Abbruchabfälle erfolgt auf einem weltweit hohen Niveau. Nach dem Bericht 2023 der Kreislaufwirtschaft Bau werden knapp 90 Prozent der anfallenden Mengen einer umweltverträglichen Verwertung zugeführt. Das liegt auch an den politischen Initiativen, die es im Land seit den neunziger Jahren gibt, wie die Kreislaufwirtschaft Bau, Baustoff Recycling Bayern oder den Umweltpakt Bayern. Dort haben sich Akteure der Baubranche mit dem Ziel zusammengeschlossen, eine Kreislaufwirtschaft im Bauwesen zu fördern und die Ressourceneffizienz langfristig zu steigern.
Auf EU-Ebene wurde im März 2020 im Rahmen des europäischen Green Deals zur Klimaneutralität der zweite EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft verabschiedet. Wie die genannten Initiativen der deutschen Baubranche hat sich die europäische Politik damit zum Ziel gesetzt, einen Markt für Recycling-Baustoffe und sekundäre Rohstoffe zu etablieren. Somit werden Produkte unterstützt, bei denen die Wiederverwertbarkeit schon bei der Entwicklung mitbedacht und geplant wird.
Den europäischen Zielen folgend hat die Bundesregierung im Mai 2021 eine neue Mantelverordnung beschlossen. Hierin werden erstmals bundesweit einheitliche Regeln für den Einsatz und die Entsorgung mineralischer Abfälle festgelegt. Um die rechtsverbindlichen Qualitätsstandards für diese Produkte deutschlandweit zu vereinheitlichen, enthält die Mantelverordnung zudem die sogenannte Ersatzbaustoffverordnung. Sie legt für ganz Deutschland die Standards zur Herstellung und Verwertung mineralischer Ersatzbaustoffe fest. Bauenden soll auf diese Weise mehr Rechtssicherheit bei der Verwendung dieser Baustoffe gegeben werden, um den Einsatz recycelter Baustoffe künftig zu steigern.
Beispiel: Wie aus Ziegeln wieder Ziegel werden
Etwa 10 Millionen Tonnen des jährlich in Deutschland anfallenden Bauschutts sind Abbruchziegel oder ziegelreiche Stoffgemische. Ein Beispiel, wie sich diese Bauabfälle sinnvoll wieder nutzen lassen, zeigt Leipfinger-Bader mit der Entwicklung seines Kaltziegels. Seit 2016 untersucht die Firmengruppe einen luftgetrockneten Mauerziegel aus recyceltem Ziegelmaterial. Dazu hat sie eine Recyclinganlage aufgebaut, die den Ziegelbruch sauber vom darin enthaltenen Dämmstoffanteil trennt.
Sie nutzt das mechanische Trennverfahren der Windsichtung, das auf Gravitation, Masse und Fliehkraft beruht. Dabei gelangen vorgebrochene Baureste gelangen mithilfe einer Separator-Schaufel in einen Windkanal. Dort werden leichte Dämmstoffpartikel nach oben abgesaugt, während die schweren Ziegelteile nach unten fallen. Die Anlage zerkleinert sie weiter und unterteilt sie in verschiedenen Körnungsstärken.
Währenddessen trennt ein Zyklonabscheider den Dämmstoff, der anschließend ausgesiebt wird. Danach ist er bereits wieder in seiner ursprünglichen Funktion verwendbar. Das gilt sowohl für Mineral- als auch für Holzfaserdämmstoffe. Beide setzt des Baustoffunternehmen als Füllung in seinen hochwärmedämmenden Ziegeln ein. Der recycelte Dämmstoff kann daher unmittelbar wieder in die Ziegelproduktion einfließen.
Die Basis des Kaltziegels bilden sortenreine Ziegelreste in besonders feinen Körnungsgrößen. Neben den entsprechenden Fraktionen aus der Recyclinganlage fallen sie beispielsweise auch beim Schleifen von Planziegeln an. Versetzt mit einer Bindemittelmischung werden die Ziegelkörnungen in einem eigens entwickelten Pressverfahren verfestigt und anschließend an der Luft bei Umgebungstemperatur getrocknet.
Ein Brennvorgang entfällt bei dieser Fertigungsweise komplett. So entsteht ein Mauerziegel, der eine besonders hohe Rohdichte aufweist und entsprechend über eine hohe Druckfestigkeit verfügt. Der Kaltziegel erfüllt somit alle statischen Voraussetzungen für tragende Innenwände und für erhöhte Schallschutzanforderungen. Die anderen in der Recyclinganlage gewonnenen Ziegelkörnungen finden eine Weiterverwertung im Wegebau oder als Substrat bei der Dachbegrünung. Künftig soll das Material aber auch wieder in die Ziegelproduktion einfließen.
Leipfinger-Bader wartet derzeit auf die Zulassung seines Recycling-Mauerziegels. Die Unternehmensgruppe benötigt für die Produktion außerdem noch Fertigungsanlagen sowie Hallenflächen zur Trocknung und Lagerung der Materialien.
Der logistische Aufwand, das zu recycelnde Material von den Baustellen wieder zum Werk zu befördern, darf nicht unterschätzt werden. Um die geschlossene Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben, bietet die Unternehmensgruppe einen eigenen Service an: Sie stellt sogenannte Big Bags zur Verfügung, in denen sich der Ziegelbruch auf der Baustelle fachgerecht verpacken und sicher zurück ins Werk transportieren lässt. Die Transportbeutel sollen dabei helfen, die Aufwandshürde herabzusenken, sodass bei der Entsorgung limitierte Zeitressourcen gespart werden. Die kostenfreie Abholung übernimmt der Ziegelhersteller.
Die Unternehmensgruppe hofft auf Unterstützung von staatlicher Seite. Nicht nur in diesem Beispiel können die Möglichkeiten staatlicher Förderungen dabei helfen, nachhaltige Lösungen zur Serienreife zu bringen. Auf diese Weise lässt sich die Müll- und Ressourcenproblematik im Bausektor langfristig in den Griff bekommen.

Bild: Leipfinger-Bader
GEB Dossier
Grundlegende Informationen zu Baustoffen -finden Sie auch in -unserem Dossier Bautechnik mit -Beiträgen und News aus dem GEB: