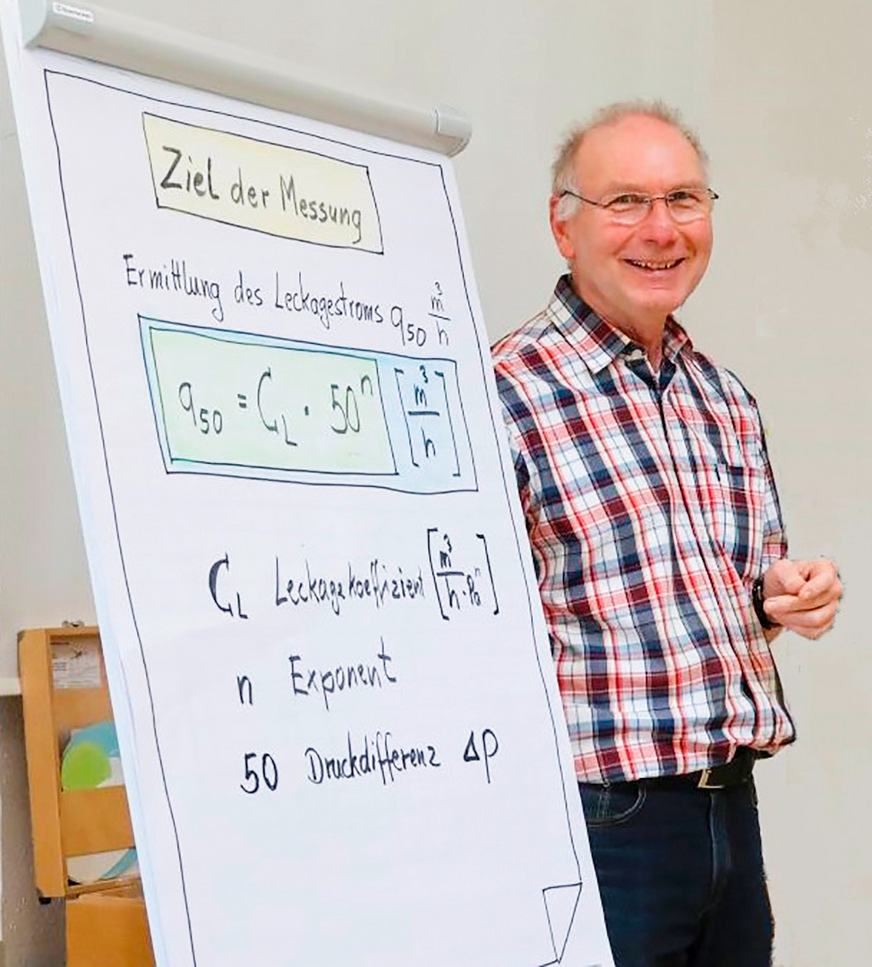Direktstrom-Heizung mit PV-Unterstützung – Ideologie oder ideale Logik? In GEB 9-2023 hat der Autor Peter Kosack mit dem Pekohaus-Konzept ein Heizkonzept propagiert, das auf der Basis einer Stromdirektheizung mittels Infrarotheizung, Warmwasser-Wärmepumpe und PV-Unterstützung bilanzielle Energieautarkie für Neubau und Gebäudebestand in Aussicht stellt. Die Befürworter der Infrarotheizung sind der Ansicht, es wäre es wirtschaftlich günstiger, Energie mit PV zu erzeugen, statt mit der Investition effiziente Energienutzung beispielsweise durch Dämmung einzusparen. Wichtig bei diesem Sichtwechsel sei es, die erneuerbare Energie massiv auszubauen, anstatt den Energieverbrauch zu minimieren. Eine provokante und in der Branche durchaus umstrittene Strategie, der einige Experten nicht nur widersprechen, sondern die angesichts dieser Logik entsetzt sind. Im Gespräch mit Wilfried Walther, Vorsitzender des Energie + Umweltzentrums am Deister, Berthold Kaufmann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Passivhaus Instituts in Darmstadt, und dem Kaufmann Bernhard Klinger, Geschäftsführer der adiuva GmbH in Frankfurt am Main, möchte die GEB-Redaktion die strittigen Punkte erörtern.
Herr Walther, überzeugt Sie das sogenannte Pekohaus-Konzept?
Wilfried Walther: Nach meiner Überzeugung werden hier die Komponenten zu stark auf das einzelne Gebäude und dessen Heizung fokussiert, andere relevante Dinge hingegen komplett außer Acht gelassen. Ich meine damit Versorgungsstrukturen und den Faktor Zeit, also die Abfolge, wann Energie erzeugt wird und wann ich Energie brauche. Herr Kosack betrachtet bilanzierte Energieströme über ein Jahr und diskutiert nicht die Probleme, die erneuerbaren Energien nun mal real haben: Im Winter sind sie leider sehr schwach. Ein gutes Konzept berücksichtig auch die „kritischen Zeiträume“ in dieser Zeit. Es gibt da diesen einen Satz, der mich förmlich aufgeschreckt hat, nämlich die These, man müsse vom Energiesparen zur Energieerzeugung wechseln.
Das Prinzip des Passivhauses ist: Gut dämmen, dichte Hülle und mit der Raumluft heizen, also: ein großes Flächenheizungssystem einzusparen. Längst gehören dazu auch PV-Module, die Energieüberschuss erzeugen. Entspricht das Passivhaus insofern nicht auch dem Prinzip einer Stromdirektheizung?
Berthold Kaufmann: Zuvorderst geht es doch darum, eine möglichst geringe Heizlast bei einem Gebäudes zu erzielen, weil man dann weniger Energie benötigt, um es zu beheizen. Hierfür braucht es essenziell die Wärmedämmung. Nur dann können eine Wärmepumpe oder andere Heizkonzepte effizient funktionieren. Es geht zuerst und vor allem darum, die Einspareffekte auszureizen. Photovoltaik-Module sind dann eine sinnvolle Zusatzinvestition. Der wichtigste Punkt ist allerdings – selbst im sehr gut gedämmten Passivhaus – dass uns die PV-Leistung nicht über die Winterlücke rettet. Wir haben in der Heizperiode immer ein Defizit, das in Zukunft mit gespeicherter Energie aus dem Sommer oder dem Netz gedeckt werden muss. Ohne Wärmedämmung wäre dieser Bedarf noch viel größer. In dem Artikel zum Pekohaus-Konzept gibt es eine Grafik, die zeigt, dass eine Wärmepumpe mehr als 75 % der Grundlast übernimmt, die Infrarotheizung den Rest, sprich nur die Spitzenlast. Das ist tatsächlich ein Konzept, das funktioniert, denn an sehr kalten Tagen braucht die Wärmepumpe „direktelektrischen Support“. Ob Heizstab oder Infrarotheizung ist nicht entscheidend. Wichtig ist aber doch die Reduktion der Heizlast – PV und Spitzenlastdeckung sind sozusagen die Sahnehäubchen, und da können wir über alles reden. Aber so zu tun, als ob bei einer Altbausanierung die Dämmung keine Rolle spiele, weil die direktelektrische Infrarotheizung unsere Probleme lösen würde, das ist Augenwischerei! Nebenbei bemerkt: Eine direktelektrische Infrarotheizung kann im Sommer nichts zur Gebäudekühlung beitragen.
Ein Argument für solche Konzepte waren auch die deutlich geringeren Investitionskosten für die Gebäudetechnik. Geht diese Rechnung langfristig auf?
Bernhard Klinger: Die Mehrzahl unserer 19 bis 20 Millionen Wohngebäude sind Unikate mit sehr vielen unterschiedlichen Bedingungen, für die es nicht das eine Heizkonzept gibt. Zudem rechnen Gebäudeeigentümer mehr in Euro, weniger in CO2-Äquivalenten. Ähnlich ist es bei der Investitionsbereitschaft: Je höher die Zinsen am Kapitalmarkt sind, umso weniger rentabel sind langfristige Investitionen. Da fragt ein Darlehensabhängiger zum Zeitpunkt der Investition nicht, ob sich jetzt ein teures, weil höheres Darlehen später mal bezahlt macht. Der hohe Zins ist also der natürliche Feind langfristig sinnvoller Investitionen. Viele Haushalte werden daher an der Investition sparen, um ihre Wohnbedürfnisse zu erfüllen, und die technisch einfache Infrarotheizung einbauen, wohl wissend, dass dies wegen der Stromkosten im Winter langfristig teurer und ökologisch nachteilig ist.
Wilfried Walther: Es ist doch unbestritten: Wir müssen so schnell wie möglich davon weg, fossile Energie in Wärme umzuwandeln. Uns läuft die Zeit davon – fragen Sie die Klimafolgenforschung. Wir haben keine Zeit mehr für Experimente! Mit unserer Technologie aus den letzten 30 bis 40 Jahren haben wir die Möglichkeit, eine hohe Effizienz im Gebäudebestand zu erreichen. Warum sollen wir das nicht nutzen? Zugleich wachsen die Fortschritte bei den Anteilen der Erneuerbaren. Das gibt mir Hoffnung. Um die Anteile der erneuerbaren Energie weiter zu steigern, bedarf es aber entsprechender Flächen für Wind und Photovoltaik. Und die Akzeptanz in der Bevölkerung hierfür ist nicht wirklich groß. Die wenige Zeit, die uns für die Energiewende bleibt, reicht nicht aus, um unsere Konzepte komplett von Fossil auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Deswegen bin ich ja dafür, in allen Punkten sehr effizient zu arbeiten. Auch die erneuerbare Energie muss sehr effizient eingesetzt werden. Wasserstoff ist doch viel zu edel, um ihn zu verbrennen. Es wäre ein Frevel, das geht nicht.
Wäre Wasserstoff für die Beheizung von Passivhäusern denkbar?
Berthold Kaufmann: Zweifellos ließe sich Wasserstoff saisonal gut speichern, und die Heizlast in Passivhäusern ist äußerst gering. Aber wie Herr Walther eben erwähnt hat: Diese zwischengespeicherte Energie wird so teuer sein, dass es nicht lohnen wird, sie nur für die Raumheizung zu verbrennen. Hier muss mit Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Wärme erzeugt werden.
Bernhard Klinger: Es ist sehr wichtig, die heutigen technischen Realitäten zu beachten. Wenn es bei uns im Winter kalt, dunkel und windstill ist, dann retten uns beim Strommix deutsche und tschechische Braunkohle und französischer und slowakischer Atomstrom. Von daher würde ich aus rein physikalischen Gründen eine Wärmepumpe gegenüber einer Infrarotheizung erstmal bevorzugen, weil sie abhängig von der Außentemperatur eine bessere Energieausbeute bringt. Zudem wäre es hilfreich, wenn wir den Strom, den wir tagsüber oder im Sommer gewinnen, effizient speichern könnten. Aus kaufmännischer Sicht ist es heute so, dass Batteriespeicher, die den Tag-Nacht-Rhythmus abbilden, ungefähr eine Rendite von Null Prozent haben, wenn man berücksichtigt, wie hoch die Anschaffungskosten und die Stromersparnis sind – gemessen am Strompreis und der Anzahl der Ladezyklen. Muss ich dazu Zinsen zahlen, ist das schlicht nicht mehr rentabel. Hinzu kommt: Die Elektrizitätsversorgungsunternehmen fragen uns nicht, wie wir in den Häusern wirtschaften, sondern wollen wissen: Was ist die maximale Anschlussleistung? Diese teilt sich dann auf in Strom für normale Haushaltsgeräte, für Wärmepumpen und für Infra-
rotheizung. In Summe reicht dann die verfügbare Anschlussleistung oft gar nicht und/oder wird dann nicht genehmigt. Das heißt, es wären zusätzliche Investitionen ins Stromnetz erforderlich, wodurch eine Infrarot-Stromdirektheizung auch Folge-
investitionen im Quartier nach sich zieht. Ob das nun bei umfänglicher Betrachtung am Ende wirtschaftlich ist und wie viel graue Energie es dafür braucht, ist im Einzelfall zu hinterfragen.
Wilfried Walther: Na also! Damit haben Sie doch genau gezeigt, dass in dem Pekohaus-Artikel die Grafik in Abb. 5 nicht aufgeht (Anm. d. Red.: Gemeint ist „Verteilung von und Wärmeenergiebedarf in der Pekohausvariante 3“).
Berthold Kaufmann: Keine Frage – wenn massiv Leistung zugebaut werden muss, wird der Energieversorger den Leistungspreis anpassen müssen, mindestens verdoppeln, wenn nicht gar verdreifachen!
Bernhard Klinger: Das bringt uns an einen weiteren Punkt: Wir haben in Deutschland einen klaren Zielkonflikt zwischen ökologischen und sozialen Zielen. Wer bezahlt die Rechnung am Ende? Allen staatlichen Subventionen zum Trotz wird es der jeweilige Bewohner sein. Ich darf die Leute nicht überfordern. Das ist die Mikroebene. Ich habe aber noch einen zweiten Blickwinkel – die Makroebene. Ich halte es für richtig, dass wir zur Rettung des Klimas auf dem Planeten CO2 einsparen. Und was wir tun, beobachten die großen Verbraucher aus China, Indien und den USA sehr genau. Die entscheidende Frage aus deren Sicht lautet nicht: Schaffen wir das technisch? Sondern: Schaffen wir das ohne wesentliche Einbußen beim Lebensstandard? Nur dann werden diese großen und viel Energie verbrauchenden Länder uns folgen in unseren Konzepten und wenn nicht, dann haben wir wunderschöne Leuchtturmprojekte hingesetzt, die aber leider weltweit keine Nachahmung finden werden. Letztlich würde die Energiewende nach hinten losgehen und wir hätten die Energie- und Gebäudewende diskreditiert, indem wir sie nicht auch wirtschaftlich effizient und sozialverträglich gemacht hätten.
Welche Konsequenzen für die Zukunft hat es, wenn sich Investitionen in den Klima- und Ressourcenschutz wirtschaftlich nicht darstellen lassen?
Wilfried Walther: Investitionen in den Klima- und Ressourcenschutz sind dringend notwendig und werden deswegen heute als nicht wirtschaftlich betrachtet, weil die Energiekosten mit denen wir rechnen, nicht die realen Kosten der Umweltzerstörung und -erhaltung beinhalten, wenn wir diese in Anspruch nehmen. Wenn sich etwas nicht wirtschaftlich darstellen lässt, aber überlebensnotwendig ist …. welche Antwort erwarten sie jetzt? Wir diskutieren hier über Kosten und Wirtschaftlichkeit, als hätten wir noch irgendeine Wahl. Das Geld ist da – es ist nur ungleich verteilt und wird andernorts investiert, wo es schadet und der Gesellschaft nichts nützt. Das ist das große Problem. Es locken die Renditen und der Luxus viel mehr als die Investitionen in Klima- und Ressourcenschutz. Es ist an der Zeit, dass auch Banken ihre Denkweisen ändern.