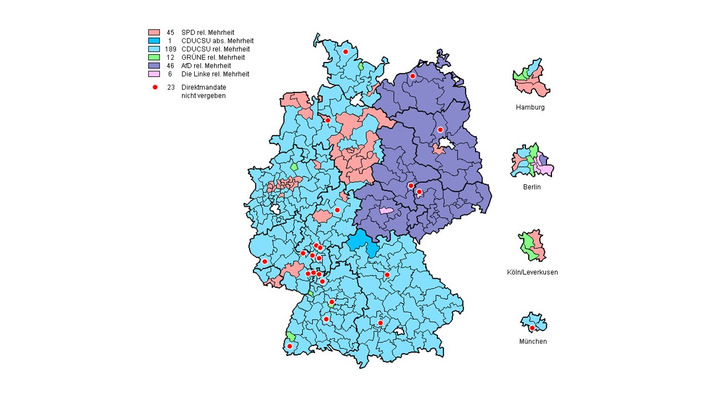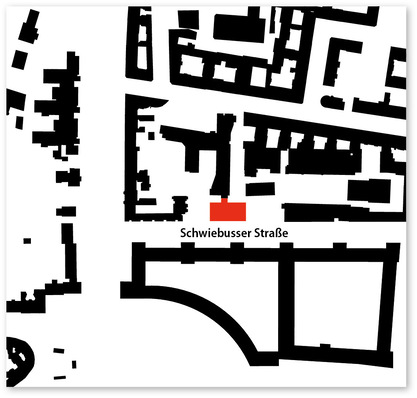Herr Berger, was macht Vilisto?
Wir stellen unseren Kunden intelligente Heizkörperthermostate zur Verfügung, mit denen sie Energie und damit auch CO2-Emissionen sparen. Wir fokussieren uns dabei ausschließlich auf Nichtwohngebäude. Unsere Kunden kommen zum einen aus dem öffentlichen Bereich – also Kommunen, Städte, Länder und Bund. Und zum anderen sind es Betriebe – das können große DAX-Konzerne sein, aber auch Mittelständler. Unsere Thermostate funktionieren präsenzbasiert. Das heißt, sie lernen mithilfe von Sensoren, wann jemand im Raum ist und wann nicht. Auf dieser Basis wird dann geheizt. Als wir 2016 begonnen haben, gab es diese Thermostate für den Nichtwohnbereich noch nicht. Wir waren gezwungen, unsere eigene Technik mit den entsprechenden Sensoren zu entwickeln, die wir europaweit patentiert haben.
Die Sensoren registrieren Schall, Licht und Bewegung.
Genau. Damit erkennen die Thermostate die Anwesenheit von Menschen. Aus den Daten erlernt dann eine künstliche Intelligenz Muster. Also sie weiß, wie zum Beispiel ein typischer Montag aussieht und wann die Räume belegt sind. So kann vorausschauend geheizt werden und die Temperatur automatisch wieder abgesenkt werden.
Warum bieten sie das nur für Nichtwohngebäude an?
Weil Menschen in diesem Umfeld nicht für die Energie zahlen. Die meisten Angestellten achten nicht darauf, die Heizung abzudrehen, wenn sie Feierabend haben. Sie denken, dass sich schon irgendjemand darum kümmert. Doch das ist in der Regel nicht der Fall. Daher bietet sich für eine vollautomatisierte Lösung in diesem Bereich sehr viel Potenzial.
Für welche Gebäude eignet sich denn eine solche Automatisierung?
Das sind klassischerweise Bürogebäude, aber wir bedienen auch Universitäten, Schulen oder Kitas. Solche Gebäude eignen sich optimal, weil die KI dort Muster erkennen kann, wie Menschen die Räume nutzen. Und bei älteren Gebäudebeständen gibt es natürlich sehr hohe Energiekosten pro Quadratmeter, die für eine kurze Amortisationsdauer der Technologie sorgen.
Ab welcher Größe lohnt sich ein Projekt?
Rein technisch gesehen funktioniert unsere Lösung schon mit einem Thermostat. Aus kommerzieller Sicht ergeben Projekte aber ab 50 bis 100 Thermostaten Sinn, weil ja auch ein gewisser Planungsaufwand dahintersteckt. Bei einem Gebäude, das extrem ineffizient ist und aus dem man sehr viel Einsparungen herausholen kann, lohnen sich eventuell auch kleinere Stückzahlen.
Mit welchem Nutzen kann man denn rechnen, wenn man solche intelligenten Thermostate nutzt?
Wir haben mittlerweile knapp 800 Gebäude mit unserer Technik ausgestattet. Und im Schnitt liegen wir bei den Energieeinsparungen, die sich damit erzielen lassen, so zwischen 20 und 30 Prozent. Das hängt dann immer sehr stark von dem jeweiligen Gebäudezustand ab. Zum Beispiel: Ist die Gebäudetechnik schon eingestellt? Gibt es eine Nachtabsenkung? Wie sind die Heizkörper verbaut?
Warum braucht man denn für eine solche Automatisierung überhaupt eine KI? Bei einem Bürogebäude müssten sich die Muster, wie die Räume belegt sind, doch relativ einfach erkennen lassen.
Rein statistisch gesehen könnte man für ein Gebäude wohl relativ einfach sagen: Die Mitarbeitenden kommen um acht Uhr morgens und gehen um 17 Uhr nach Hause. Aber wir stellen fest, dass es sehr viele individuelle Fälle gibt, in denen jemand schon um sechs Uhr morgens kommt oder vielleicht der Geschäftsführer bis 20 Uhr bleibt. Und das bedeutet, dass die Heizungsanlage in solchen Fällen die gesamte Zeit durchläuft. Um dies zu automatisieren, müsste man immer auf den größten gemeinsamen Nenner programmieren. Also von fünf Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Und damit verliert man extrem viele Stunden, in denen man die Heizung eigentlich absenken könnte. Ich kann Ihnen dazu auch zwei Beispiele nennen.
Bitte schön.
Gerade bei öffentlichen Gebäuden sind häufig Halbtagskräfte tätig. Es gibt also Büros, die am Nachmittag gar nicht genutzt werden. Und es gibt Mitarbeitende, die an bestimmten Tagen im Homeoffice sind. Trotzdem würden die Räume durchgeheizt werden, weil man das ohne eine KI nicht raumindividuell und tagesgenau steuern kann. Ein anderer sehr plakativer Case ist eine Schule in Berlin, die wir mit unseren Thermostaten ausgestattet haben. Der Unterricht endet gegen 15 Uhr, aber die Heizung lief vor Installation unserer Technik wegen der Elternabende immer bis um 22 Uhr, obwohl für diese jeweils immer nur ein Raum genutzt wird. Insgesamt wurden drei Gebäude dafür beheizt. So etwas lässt sich manuell nicht lösen.
Ihre Thermostate erfassen ja Daten über Mitarbeitende und deren Aufenthalt im Büro. Ich könnte mir vorstellen, dass dies oft zu Diskussionen mit den Betriebsräten führt.
Dies ist ein Thema, das fast jeder Kunde anspricht. Daher haben wir uns vor ein paar Jahren dazu entschieden, ein Datenschutzzertifikat zu erwerben. Denn die Daten, die wir erheben, sind aus Sicht der DSGVO relevant, weil sie mittelbaren Personenbezug haben. Wir wissen zwar nicht, welche Person sich in einem Raum befindet. Aber natürlich könnte man mithilfe von Raumbelegungsplänen gewisse Zusammenhänge herstellen. Daher arbeiten wir auf Basis von entsprechenden Auftragsverarbeitungsverträgen, die uns befähigen, diese Daten im Auftrag des Kunden zu verarbeiten. Die Daten werden außerdem nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Und unser Ansprechpartner beim Kunden erhält keinen Zugriff auf alle Rohdaten. Er kann zum Beispiel keine Präsenzdaten einsehen.
Vilisto bietet auch die Möglichkeit, mithilfe der intelligenten Thermostate einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Wie funktioniert das?
Das lässt sich relativ einfach erklären. Das Ziel eines hydraulischen Abgleichs ist ja, dass jeder Raum ungefähr gleich schnell erwärmt wird. Mit den Sensoren in unserem Thermostat lassen sich Temperaturänderungen beobachten. Und dahinter arbeitet ein Algorithmus, der sich alle Thermostate gleichzeitig anschaut und dann steuert, dass solche Räume, die langsamer warm werden, mehr Volumenstrom erhalten. Und bei Räumen, die schneller warm werden, wird der Volumenstrom reduziert. Dies wird minütlich an die jeweilige Lastsituation angepasst. Daher handelt es sich um einen adaptiven hydraulischen Abgleich. So kann die Wärme immer optimal verteilt werden. Unsere Lösung ist dem Verfahren B gleichgestellt und wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert.
Welche Möglichkeiten für die Heizungsoptimierung werden sich in Zukunft noch durch KI erschließen lassen?
In Zukunft werden wahrscheinlich sehr viele Gebäude mit einer Wärmepumpe geheizt werden. Und da kann man sich schon die Frage stellen, wie man auf Basis der Daten, die wir heute schon erheben, ein Lastprofil erlernen kann, um die Wärmepumpe in Zukunft besser auslegen zu können. Man braucht Verfahren, um Sensordaten und alle anderen Informationen, die verfügbar sind, dafür nutzen zu können. Und es wird wahrscheinlich in Zukunft effizienter sein, diese dann mit KI auszuwerten.
Die Fragen stellte Markus Strehlitz.

Bild: Christoph Berger