Es ist ein Problem, das man schon in der Antike wälzte: Wann wird aus einem Nichthaufen ein Haufen? Nicht, wenn einem Reiskorn ein Zweites hinzugefügt wird; auch nicht, wenn ein Drittes hinzukommt. Irgendwann aber ist es soweit: ein Haufen ist entstanden. Dennoch kann keiner eine exakte Zahl von Reiskörnern benennen, ab denen ein Haufen besteht. Diese Frage bewegt uns Menschen seit der Antike, als sogenannte Sorites-Paradoxie. So viel vorneweg: Es gibt keine einfache Lösung.
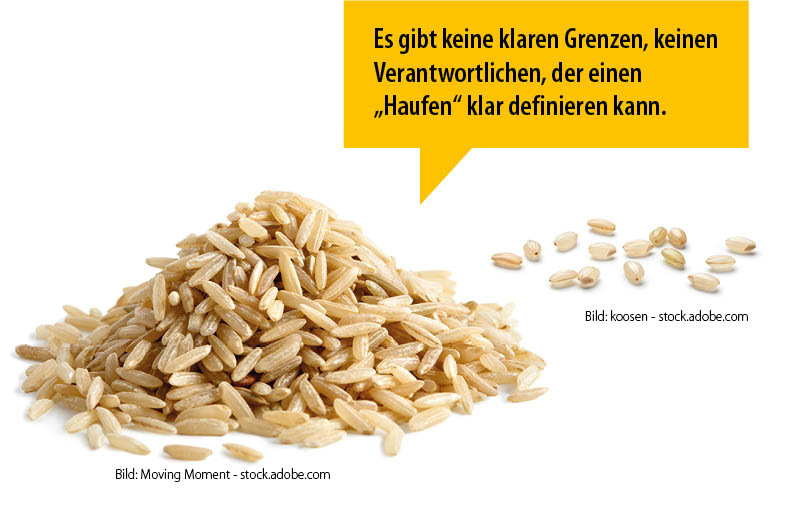
In welcher Welt wollen, in welcher Welt werden wir leben?
Dennoch ist die Frage von großer Bedeutung für jeden Menschen, für jede Gemeinschaft. Ganz konkret beim Umgang mit Energieverbrauch und Umweltschutz. Nur weil eine Lampe drei Minuten länger brennt, die Tür zum Keller länger als nötig offensteht oder der alte Wäschetrockner sechs Monate später ausgetauscht wird, steigt der Energieverbrauch doch kaum messbar an, die Umwelt ist nicht messbar geschädigt. Wenn sich alle Menschen so verhalten jedoch mit Sicherheit. Wo jedoch die Grenze liegt, wo aus dem Reiskorn ein Haufen wird, bleibt unklar.
In noch größerem Maßstab stellt sich die Frage für die Gesellschaft. In welcher Welt wollen, in welcher Welt werden wir leben? Ein Haus im Landschaftsschutzgebiet verändert weder dessen Charakter noch die Schutzwürdigkeit. Ebenso wenig ein Zweites oder Drittes. Irgendwann aber wird aus dem Nichthaufen ein Haufen, sprich das Gebiet ist nicht mehr schützenswert. Eine Fahrt mit dem Auto verändert nicht das Klima, Autofahren aber schon. Der Sachverhalt ist eindeutig: keine Gesellschaft kann funktionieren, kann fortbestehen, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen, die so denken und handeln, überschritten wird. Bedenklich oder gar gefährlich wird es, wenn das sogenannte Trittbrettfahren einen gewissen Punkt überschreitet.
Dennoch bliebt das bereits aufgezeigte Problem: Es gibt keine klaren Grenzen, keinen Verantwortlichen, der einen „Haufen“ klar definieren kann. Es gibt kein Raum- oder Gewichtsmaß, keinen Geldbetrag, der die ultimative Lösung ist. Und es gibt auch keinen Energieberater, der die Grenze zum Haufen quantifizieren kann. Genaue Grenzen fördern sogar die Trittbrettfahrer-Mentalität, weil Betroffene erkennen, dass ein Haufen (noch) nicht gebildet, eine Grenze noch nicht erreicht bzw. durch ihr Handeln überschritten wird. Das bestätigt die Ansicht, dass das eigene Trittbrettfahren für die Gemeinschaft ohne erkennbare bzw. sichtbare Folgen bleibt.
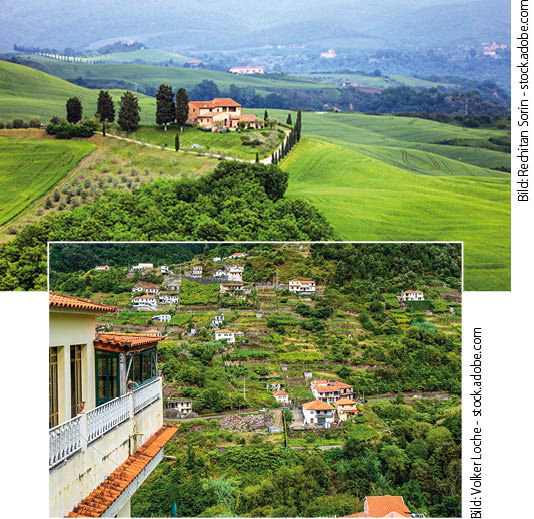
Lösungsansätze in Gesellschaft und Umwelt
In einer kleinen Gemeinschaft, in der Familie, als soziale und wirtschaftliche Keimzelle, bliebt Trittfahren weder unbemerkt noch folgenlos. Sanktionen folgen meist unmittelbar, wenn der Einzelne mehr nimmt als ihm zusteht bzw. er gibt. Größere Gemeinschaften benötigen und implementieren Regeln, um Trittbrettfahren zu vermeiden. Damit sind Unternehmen eher mit dem Trittbrettfahren konfrontiert als Familien, wird im Betrieb eher Energie verschwendet als im Privathaushalt.
Bei der Suche nach Lösungen werden zwei unterschiedliche Vorgehensweisen miteinander verbunden. Die erste Lösung resultiert aus konkreten Verhaltensvorgaben, die meistens schon vor langer Zeit religiös definiert wurden, wobei die Zehn Gebote sicherlich den bekanntesten Katalog darstellen. Neun Gebote sind dabei negativ formuliert: „Du sollst nicht …“. Eine Ergänzung zielt auf generelle Verhaltensnormen ab, wie sie Jesus in der Vorgabe: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ formuliert hat. Auch der Kategorische Imperativ von Immanuel Kant zielt in diese Richtung: „Handle stets so, dass dein Handeln die Grundlage eines allgemeinen Gesetzes sein kann“.
Menschliches Handeln erfolgt jedoch selten derart eindeutig, rigoros. Gilt ein bestimmtes Verhalten als „Verstoß“ oder ist es nur eine „flexible Auslegung“ einer Regel? Ist eine, nur eine einzige Ausnahme vom Kategorischen Imperativ wirklich schlimm oder nur menschlich? Sie sehen – die eingangs formulierte Frage lässt sich nicht abschließend beantworten: Wo bzw. wann fängt der Haufen an?
Das Energiemanagement bezieht sich auf die angeführten Lösungsansätze einer Gesellschaft. Einzelne quantifizierte Vorgaben werden erstellt, zunehmend gesetzliche Ver- bzw. Gebote erlassen, ergänzt um Argumente, die die Vorteile des Energiesparen aufzeigen. Dies reicht jedoch nicht aus.

Bild: Mushy - stock.adobe.com
Lösungsangebote der Logik
Jede scheinbare „Lösung“ beruht auf unplausiblen Modifikationen menschlicher Überzeugungen. Die „Lösung“ besteht vielmehr darin, dass andere, ebenso schwere Paradoxien aufgezeigt und Akteure damit konfrontiert werden.
Ein Argument gegen Trittbrettfahrer liefert das Rätsel der harmlosen Folterknechte. 1000 Folterknechte hatten jeder ein anderes Opfer. Jeder Folterknecht drückte tausendmal auf den Knopf des Folterapparates. Die Wirkung, den zusätzlichen Schmerz durch einen einzelnen Knopfdruck, nimmt kein Opfer wahr. Aber die kumulierte Wirkung von 1000 Knopfdrücken erzeugt entsetzliche Schmerzen. Jedes Opfer leidet durch separate, aber baugleiche Foltergeräte. Den Folterern kommen moralische Skrupel. Sie ändern ihre Arbeitsweise: Jeder Folterknecht drückt den Knopf eines Folterapparates nur ein einziges Mal, dafür aber bei jeder der 1000 Maschinen. Kein Folterer verschlimmert den Schmerz eines einzelnen Opfers, dennoch erleiden die Opfer die gleichen grauenhaften Qualen [1, S. 159]. Dieses Bild zeigt auf, was Trittbrettfahren tatsächlich bewirkt. Die einzelne Aktion mag als Kleinigkeit, als Bagatelle wirken, dass Gesamtbild jedoch zeigt die verheerenden Folgen auf.
Eine andere Perspektive bietet das folgenden Gedankenspiel: Im Rückgriff auf den Einwand gegen Trittbrettfahren lassen sich drei Fälle konstruieren [1, S. 185]:
Damit rückt die Frage, wie viel genug ist, ob es einen Grenz- oder Kipppunkt gibt und wie dieser erkannt wird, in den Fokus. Wenn dieser Punkt unbekannt, ungewiss oder umstritten ist, kommt dies einer Einladung zum Trittbrettfahren gleich. Die praktische Schwierigkeit ist, dass sich Kipppunkte fast ausschließlich erst in der Rückschau ermitteln lassen, wann ein Staat, eine Gemeinschaft oder ein Unternehmen an diesem Punkt stand und ihn überschritten hat.
Auch wenn es keinen Kipppunkt gibt, soll der Einzelne nach der oben dargestellten Perspektive nur einen Beitrag leisten, wenn die Situation noch knapp unterhalb des Grenzwertes liegt. Denken alle so, führt dies dazu, dass erst im letzten Moment ein Beitrag geleistet wird. Verkalkuliert sich aber nur eine Person, scheitert das gesamte Projekt, alle verlieren. Dies führt zu einer riskanten Lebensweise, zu einer hochgradig instabilen Gesellschaft, zu einer Gemeinschaft oder einem Projekt, das permanent an der Schwelle zum Scheitern steht. Meint der einzelne Trittbrettfahrer tatsächlich, diesen Zeitpunkt zu erkennen, um dann sein Verhalten umzustellen?
Das Thema ist und bleibt komplex. Eine einfache Faustregel soll helfen: Leisten Sie einen Beitrag, wenn nach Ihrer Einschätzung der langfristige Nutzen aus einer gemeinschaftlichen Anstrengung mindestens so groß ist wie die Kosten Ihres Beitrags [3, S. 190].
Umsetzung im Energiemanagement
Das Thema Trittbrettfahren ist in der Energieberatung quasi omnipräsent. Ein Trittbrettfahrer lehnt Vorgaben nicht kategorisch ab, verstößt auch nicht laufend dagegen, konstruiert allerdings im Einzelfall ein Erklärungsmodell, das den speziellen Verstoß plausibilisiert und rechtfertigt, wobei sich die Argumente nicht auf den Einzelfall, sondern ein Verhaltensmuster beziehen. Einen Gesamtüberblick, eine Betrachtung der Auswirkungen sämtlicher Folgen verweigert er sich, vergleichbar mit den erwähnten Folterknechten. Für den Einzelnen ist der Verstoß ein Reiskorn, für das Energiemanagement aber ein Reishaufen.
Da sich kein Trittbrettfahrer als solcher zu erkennen geben wird, können Argumente nur an die Gesamtheit der Betroffenen adressiert werden, wobei diese nicht unter Generalverdacht gestellt, aber dazu aufgefordert werden sollen, sich dem Phänomen dort entgegenzustellen, wo es offenkundig wird. Da die Frage des Klimaschutzes ebenfalls unter das Oberthema fällt, darf das Interesse vieler Beteiligter, insbesondere der jüngeren Generation, vorausgesetzt werden.
Der bzw. die Betroffenen dürfen selbst keine Trittbrettfahrer sein, wenn sie kein Trittbrettfahren wünschen. Im Privatleben ist dieses Verhalten leichter zu identifizieren als in der Wirtschaft. Unternehmen müssen sich der Frage grundsätzlich stellen. Sie machen sich unglaubwürdig, wenn sie Trittbrettfahren in einem Bereich ablehnen, dies in einem anderen aber selbst praktizieren. Insbesondere ESG-Sachverhalte (Environmental Social Governance, zu deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sind damit kein Schönwetterthema. So bürokratisch auch Lieferketten-Vorgaben erscheinen, so notwendig sind sie, um ein Trittbrettfahren des Unternehmens zu vermeiden. Gleiches gilt für steuervermeidende Unternehmen, die mittels internationaler Gestaltungsmöglichkeiten lächerlich niedrige Steuern für Gemeinschaftsaufgaben entrichten. Mitarbeiter vergleichen Darstellung nach Außen und Realität nach Innen miteinander. Nehmen vor allem das Handeln der Unternehmensleitung als das wahr, was es ist: als Vorbild.
So pathetisch es klingen mag: Organisationen müssen einen Nutzen über die reine Verdienstmöglichkeit für deren Mitglieder hinaus bieten und vermitteln. Auf dieser Basis kann das Problem des Trittbrettfahrens erfolgreich adressiert werden.
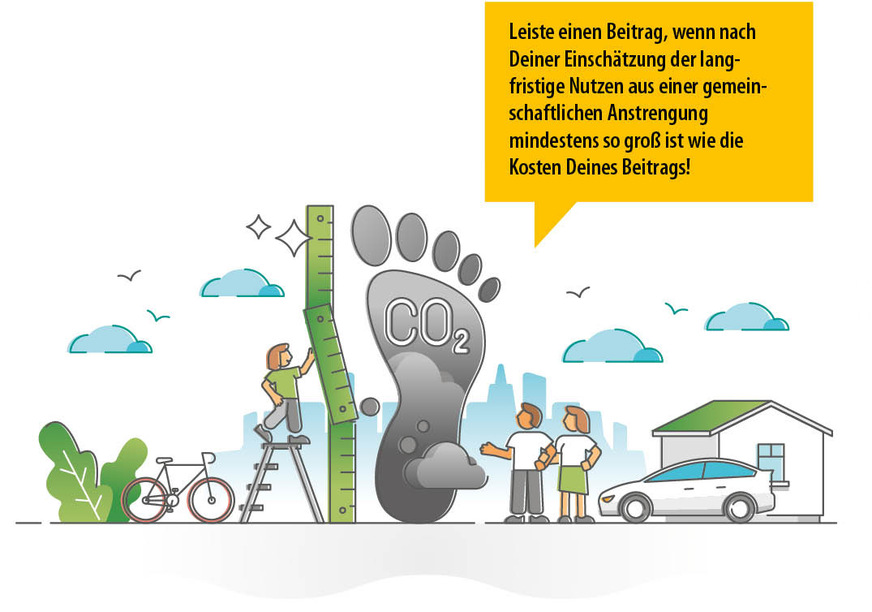
Bild: © VectorMine - stock.adobe.com





![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)


