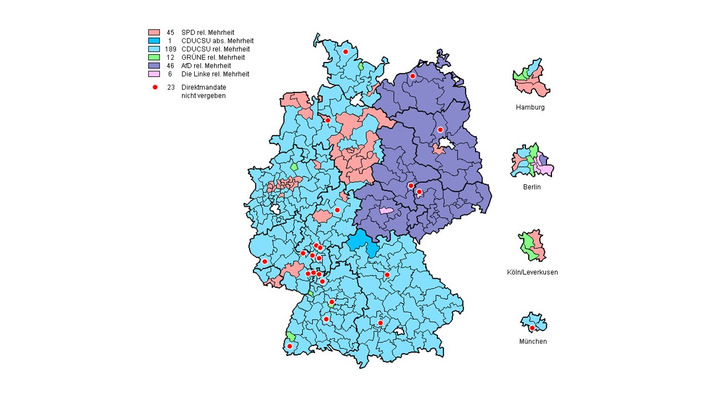Die Bundesrepublik will bis 2045 die Fernwärme komplett ohne CO2-Emissionen bereitstellen. Doch dies ist eine echte Herausforderung. Denn ein großer Teil dieser Fernwärme wird immer noch mit Kohle produziert. Deshalb haben sich die Forscher:innen der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geotechnologie (IEG) angeschaut, welche Möglichkeiten große Wärmepumpen bieten, um die Fernwärmenetze zu dekarbonisieren.
Ökonomische Hemmnisse analysiert
Im Mittelpunkt der Untersuchung stand unter anderem die Frage, wie Großwärmepumpen natürliche und industrielle Wärmequellen für eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung nutzen können. Außerdem haben die Forscher:innen die aktuellen ökonomischen Hemmnisse analysiert. Daraus entstanden Vorschläge für die Weiterentwicklung der ökonomischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Großwärmepumpen.
Am Anfang stand aber die Analyse, wie viel Kohle tatsächlich in der Fernwärme steckt. Nach Angaben der Bundesnetzagentur gibt es in Deutschland 123 Kraftwerksblöcke, die Wärme auskoppeln. Das ist die überwiegende Mehrheit der 141 Kohlemeiler, die bundesweit noch in Betrieb sind. Diese fossil befeuerten KWK-Anlagen müssen innerhalb der nächsten 20 Jahre komplett ersetzt werden.
Alle Kohlekraftwerke ersetzen
Eine Alternative zur fossilen Wärmeerzeugung sei die Einbindung natürlicher Wärmequellen wie Luft, Gewässer und geothermale Wärme, betonen die Wissenschaftler:innen der Fraunhofer IEG. Zusätzlich kann industrielle Abwärme, kombiniert mit Großwärmepumpen, einen erheblichen Teil der Fernwärme bereitstellen und damit einen Beitrag zur Dekarbonisierung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung leisten. Diese können bestehende Kraftwerksblöcke als Wärmequelle anteilig oder komplett ersetzen, zeigen die Untersuchungen.
Fraunhofer IEG veröffentlicht Infoportal zu Großwärmepumpen
Ausreichende Wärmquellen vorhanden
Bei der Analyse der Potenziale der Großwärmepumpen in der Fernwärmeversorgung haben sich die Forscher:innen der Fraunhofer IEG angeschaut, ob sich bereits existierende Wärmequellen an acht exemplarischen Kraftwerkstandorten für solche Anwendungen eignen. Sie haben analysiert, welchen Anteil der Wärmenachfrage diese großen Wärmepumpen decken können. Die Expert:innen haben dabei deren Eignung aufgrund der zeitlichen und räumlichen Verfügbarkeit von natürlichen Wärmequellen, der Temperaturniveaus, sowie netzspezifischer Charakteristika bewertet.
Die Ergebnisse zeigen: Niedertemperatur-Wärmequellen sind in vielen Fällen einfach verfügbar. Diese können als Wärmequelle für Großwärmepumpen dienen und so den Fernwärmebedarf in Deutschland anteilig oder sogar komplett decken.
Lage und Infrastruktur sind entscheidend
Allerdings hängt das verfügbare Wärmeangebot aus natürlichen und künstlichen Quellen jedoch stark vom Standort ab. Dabei spielen die geografische Lage und die vorhandene Infrastruktur an Kraftwerksstandorten zur weiteren Nutzung eine wichtige Rolle. „Mit Großwärmepumpen lassen sich natürliche Wärmequellen effizient nutzen und die Wärmeerzeugung aus Kohle schrittweise ersetzen“, erklärt Anja Hanßke, Projektleiterin des Forschungsprojekts FernWP, das federführend von der Fraunhofer IEG durchgeführt wurde.
Ziel 2025 erreicht: München versorgt sich mit Ökostrom
Effiziente Nutzung ist möglich
Dies eröffne neue Perspektiven für eine nachhaltige Fernwärmeversorgung, sagt sie. So haben die Forscher:innen gezeigt, dass Großwärmepumpen gegenüber konventionellen Technologien im Betrieb viel flexibler sind. Denn sie kommen mit unterschiedlich warmen Quellen zurecht und können diese effizient nutzen. Sie können so nach Anforderung der Fernwärmenetze grüne Fernwärme anbieten. Zudem binden Großwärmepumpen erneuerbare Energiequellen effektiv ein. Diese Effizienz kann durch die Senkung der Vorlauftemperatur in den Wärmnetzen weiter erhöht werden.
Ausreichend Potenzial vorhanden
Allerdings müssen beim Einsatz der Technologie die spezifischen Bedingungen in den verschiedenen Regionen Deutschlands beachtet werden. Dazu gehören die Bevölkerungsdichte und bereits vorhandene Infrastruktur. Für den Umstieg von Kohle auf Großwärmepumpen sind natürlich entsprechende Investitionen für den Umbau der Kraftwerksstandorte notwendig. Wenn in der Nähe der Kraftwerke aber Wärmequellen vorhanden sind – seien es Fließ- oder Oberflächengewässer, Geothermie oder Solarthermie – bieten aufgrund dieser Quellen ausreichend Potenzial, um auf Großwärmepumpen umzusteigen und diese wirtschaftlich zu betreiben.