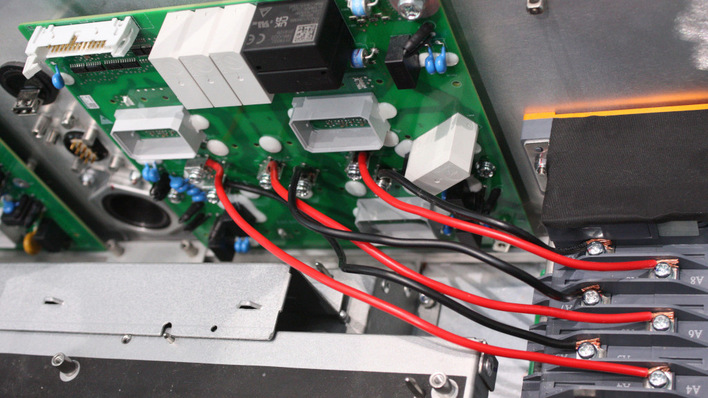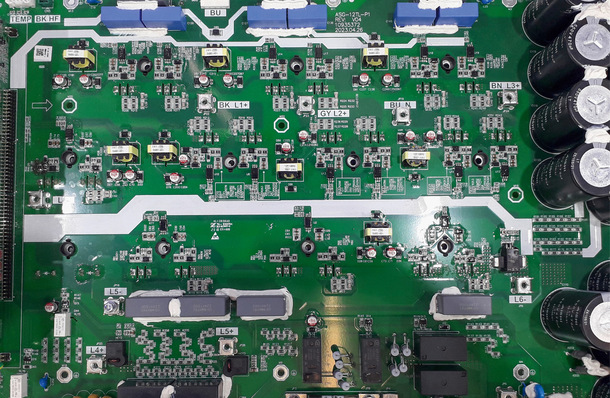Welche Ziele verfolgt der europäische Branchenverband Solar Power Europe in der Cybersicherheit?
Jan Osenberg: So einfach es klingt: Wir wollen die Photovoltaik sicherer machen. Nur dann wird die Versorgungssicherheit gewährleistet, wenn Solarstrom künftig 20 bis 30 Prozent des Stromverbrauchs in der EU deckt. Manche mögen es seltsam finden, dass wir mehr Regeln für die Branche fordern. Aber der Erfolg der Energiewende hängt von unserer Rolle als verantwortungsbewusster Sektor ab, der aktiv an der Zukunftssicherheit unserer Technologie arbeitet.
Also geht es darum, europäische Anbieter von Solaranlagen durch höhere Cybersicherheit zu stärken?
Das ist ein positiver Nebeneffekt unserer Arbeit. Effektive Maßnahmen zur Cybersicherheit erfordern ein gewisses Maß an Lokalisierung in Europa, was wiederum die lokalen Hersteller stärkt. Bei Solar Power Europe haben wir zudem einen separaten Arbeitsbereich, der sich der Stärkung der europäischen Industrie widmet, beispielsweise durch die Solar Manufacturing Facility oder den Net Zero Industry Act (NZIA).
Bedeutet mehr Cybersicherheit, dass chinesische Hersteller aus Europa verdrängt werden?
Es ist verlockend, Cybersicherheit als Vorwand zu nutzen, um die europäische Industrie zu stärken. Das ist nicht unser Ansatz. Industriestrategie erfordert einen eigenen, umfassenden Ansatz. Marktzugang und Cybersicherheit sind verschiedene Dinge. Wenn wir über Cybersicherheit sprechen, müssen wir uns in erster Linie darauf konzentrieren, Photovoltaikanlagen sicherer zu machen. Jeder Anbieter muss bestimmte Anforderungen erfüllen, unabhängig von seiner Herkunft. Nur so können wir die gesamte Branche stärken. Reduziert man Cybersicherheit nur auf die Herkunft des Herstellers, werden unter Umständen wichtige Sicherheitsrisiken übersehen.
Das Risiko eines Hackerangriffs besteht unabhängig von der Herkunft der Komponenten?
Das größte Cybersicherheitsproblem in der Photovoltaik sind terroristisch motivierte Angriffe. Sie finden heute bereits statt. Täglich greifen russische Hacker das europäische Stromnetz an. Finanziell motivierte Hacker zielen auf Anlagen auf Gewerbedächern ab, um Zugriff auf IT-Systeme zu erhalten.
Sie erwähnten Risiken durch Russland. Spielen geopolitische Risiken durch China für Solar Power Europe keine Rolle?
Das Szenario eines zukünftigen Konflikts zwischen China und der EU ist zwar relevant, aber im Vergleich zu diesen sehr realen und gegenwärtigen Risiken eher spekulativ. Um diese Bedrohungen zu eliminieren, müssen wir das Sicherheitsniveau auf breiter Front erhöhen.
Können europäische Hersteller durch hohe Standards in der Cybersicherheit punkten?
Hier gibt es zwei Dimensionen. Einerseits meiden Entwickler und Installateure aus genau diesem Grund bereits viele chinesische Produkte. Andererseits wird die EU angesichts der geopolitischen Lage mit ziemlicher Sicherheit strengere gesetzliche Anforderungen einführen, um die Abhängigkeit von China zu verringern und die europäische Widerstandsfähigkeit und Souveränität zu stärken. In diesem Zusammenhang haben europäische Hersteller, die weniger von China abhängig sind, einen Vorteil. Sie können strengere regulatorische Standards leichter erfüllen.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Es ist möglich, dass Wechselrichter künftig Updates und tägliche Kontrollen durchführen müssen. Europäische Hersteller können dies leichter gewährleisten als chinesische Anbieter. Dies ähnelt den aktuellen EU-Datenschutzbestimmungen. Sie besagen, dass die Kontrolle über europäische Daten nicht aus der Zuständigkeit der EU oder von Ländern mit gleichwertigen Sicherheitsvorkehrungen herausfallen darf.
Was muss Brüssel tun, um europäische Hersteller von Wechselrichtern und Speichern zu unterstützen?
Wir schlagen ein spezielles Programm vor, das Forschung und Entwicklung stärkt. Es sollte für intelligente und sichere Elektrifizierung gelten – also für Wechselrichter, Batterien, Wärmepumpen und Ladestationen. Die beteiligten Unternehmen sollten öffentliche Förderung erhalten, um sie in ihrer Innovationsfähigkeit zu unterstützen. Zu diesem Zweck bilden mehrere EU-Mitgliedstaaten und Unternehmen ein Forschungskollektiv.
Welche weitere Förderung ist erforderlich?
Wir benötigen Ausschreibungen, die nichtmonetäre Kriterien wie Qualität oder lokale Anteile berücksichtigen. Dies kann zur stärkeren Diversifizierung gegenüber China führen und die europäischen Hersteller stärken.
Peking nimmt viel Geld in die Hand, um seine Industrie zu stützen. Wann greift die EU einheimischen Herstellern unter die Arme?
Finanzielle Unterstützung für Produktionskapazitäten in Europa ist notwendig – dies umfasst sowohl die Investitionskosten für den Kapazitätsaufbau als auch die laufende Finanzierung des Betriebs. Leider hat die EU Ende Juni ihre Subventionsregeln für staatliche Beihilfen aktualisiert.
Mit welchem Ergebnis?
Für die Schwerindustrie sind Hilfen verfügbar – dies gilt jedoch nicht für europäische Solarhersteller. Daher ist es jetzt wichtiger denn je, dass die Europäische Kommission rasch eine Clean Tech Manufacturing Bank einrichtet, einschließlich einer Solar Manufacturing Facility. Sie könnte Projekte mit produktionsgebundener Hilfe unterstützen und die Betriebskosten für neue Fabriken decken.
Wie kann sich der Branchenverband besser mit der Industrie vernetzen?
Ein Beispiel: Wir haben gerade die Battery Storage Europe Platform ins Leben gerufen. Sie ist eine neue, engagierte Stimme für Batterien in Europa, sowohl für deren Herstellung als auch für den Einsatz. Sie wird sich für robuste gesetzliche und investitionsbezogene Rahmenbedingungen für Batteriespeicher einsetzen.
Wie groß ist die Resonanz aus der Wirtschaft?
Wir hatten gerade unseren ersten offiziellen Strategietag in Brüssel. Über 50 Unternehmen nahmen daran teil. Die neue Plattform entwickelt den Fahrplan für die Branche, um den Bedarf an Batterien zu decken und die Aktivitäten von Solar Power Europe zu Flexibilität und Wechselrichtern zu ergänzen.
Das Interview führte Hans-Christoph Neidlein von PV Europe.
Jan Osenberg
leitet das Fachgebiet Systemintegration bei Solar Power Europe, ein kleines Team für Netze, Flexibilität, Märkte und Investitionen, Elektrifizierung und Wasserstoff, Solardächer und Digitalisierung. Er hat Energietechnik an der TU München studiert.
https://www.solarpowereurope.org/

Foto: Solar Power Europe