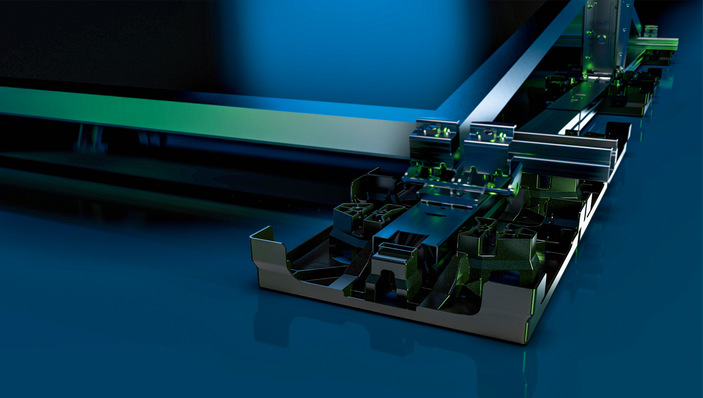Sie haben zur Einstimmung auf den Stadtwerkekongress im Interview gesagt, die kommunalen Versorger operierten in der Situation eines hybriden Krieges. Wollen Sie die Stadtwerke in die Wehrtüchtigkeit des Landes und in die Resilienzdebatte einreihen?
Ingbert Liebing: In die Resilienzdebatte allemal. Wir kommen an der Tatsache nicht vorbei, dass wir in einer Auseinandersetzung, in einer hybriden Auseinandersetzung sind. In der Energiewirtschaft werden wir tagtäglich angegriffen. Entweder durch Cyberattacken, durch Spionage oder durch Sabotage. Dies ist aktuell Gegenstand von politischen Beratungen: im Rahmen der Beratungen des Nis2-Umsetzungsgesetz für Sicherheit im Cyberraum und des Kritis-Dachgesetzes über die physische Sicherheit. Die Energieinfrastruktur, alle kritischen Infrastrukturen, stehen im Fokus von Angreifern. Und deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten.
Ist langfristig für die Stadtwerke nicht aber die andere Resilienz bedeutender: Auf klimawandelbedingte Energieversorgungsprobleme als kommunale Einheiten die Versorgung flexibler und widerstandsfähiger abdecken zu können, als es zentrale Großversorgungsstrukturen vermögen?
Ingbert Liebing: Das ist kein Entweder-Oder. Die Stadtwerke werden im Moment physisch angegriffen. Und das ist etwas, wo wir auch ausdrücklich sagen: Das muss ernst genommen werden. Da erwarten wir auch mehr Unterstützung seitens der Politik. Da muss auch der Staat mehr Verantwortung für Sicherheit übernehmen. Der Schutz der Unternehmen in der kritischen Infrastruktur kann nicht Aufgabe der Unternehmen alleine sein. Hier müssen wir darüber sprechen, was künftig Unternehmensaufgabe und was staatliche Aufgabe ist. Und in der letzten Zeit sind die Bedrohungen in dem Bereich deutlich gewachsen. Deswegen geht es um beides.
Um dennoch nochmal auf diesen Punkt zu kommen: Sehen Sie die Resilienz gegen klimawandelbedingte Energieversorgungsprobleme überhaupt noch als wichtiges Thema der Stadtwerke?
Ingbert Liebing: Selbstverständlich ist dies für die Stadtwerke ein relevantes Thema.
Die VKU-Tagung setzt derweil unterhalb dieser aktuellen äußeren Umstände ein Versorgungshauptthema ja klar in den Vordergrund, nämlich die Wärmewende. 82 Prozent der Stadtwerke sagen in einer VKU-Umfrage, deren Kosten seien auf bisherigem Wege und nur aus kommunalen Mitteln nicht zu stemmen. Der VKU sagt, die Förderung müsste verdreifacht werden – Sie fordern diese 3,5 Milliarden Euro schon länger. Ist der Wärmejob ohne das nicht zu stemmen?
Ingbert Liebing: Die Wärmewende muss gelingen. Aber die jetzigen Rahmenbedingungen reichen dafür nicht aus. Deswegen erwarten wir jetzt zügig Entscheidungen. Wir fordern einen Winter der Entscheidungen für die Wärmewende.
Die Frage ist: Was heißt es denn konkret, wenn im Koalitionsvertrag steht, das Heizungsgesetz werde abgeschafft, das Gebäudeenergiegesetz wird novelliert, und europäisches Recht wird umgesetzt. Da erwarten wir jetzt zügig konkrete Entscheidungen. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Kommunen, unsere Eigentümer, mitten in der kommunalen Wärmeplanung sind. Die Großstädte sollen bis Mitte nächsten Jahres die Wärmeplanung abgeschlossen haben und brauchen Klarheit, wohin die Reise geht.
Deswegen werben wir dafür, dass diese Entscheidungen schnell getroffen werden. Aber es geht eben auch um entsprechende Finanzierung. Wir brauchen verlässliche, höhere finanzielle Infrastrukturförderung.
Eine Milliarde Euro hat die Politik schon dafür bestimmt.
Ingbert Liebing: Im Moment, nämlich im nächsten Jahr eine Milliarde. Wir gehen davon aus, dass wir auf mittlere Sicht mindestens 3,5 Milliarden Euro jedes Jahr benötigen. Denn wenn jetzt die kommunale Wärmeplanung 2026 für die Großstädte, 2028 für die kleineren Städte und Gemeinden abgeschlossen wird, dann muss ja danach die Phase der Umsetzung kommen. Und dann wird erst der Hochlauf der Projekte und die Vielzahl von Anträgen kommen, die jetzt noch gar nicht vorliegen. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Zudem geht es um den Rechtsrahmen mit den allgemeinen Versorgungsbedingungen der Fernwärme, der Wärmelieferverordnung und den KWK-Gesetzen. Sie müssen Sicherheit bis weit in die 30er Jahre hinein bieten.
Sie sprechen vom „Winter der Entscheidung für die Wärmewende“. Was ist denn am wichtigsten, was dieses Jahr noch an Entscheidungen kommen muss?
Ingbert Liebing: Als erstes brauchen wir bezogen auf die Wärmewende zügig Klarheit. Was bedeutet die Ankündigung, das Heizungsgesetz abzuschaffen? Wir erwarten zügig die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes, damit neue Projekte eine Perspektive haben, die im Moment fehlt. Und wir erwarten zügig Klarheit, welche Konsequenzen aus dem Monitoringbericht zum Stand der Energiewende gezogen werden. Im Moment sind die von Frau Reiche dazu geschriebenen zehn Punkte sehr allgemeine Überschriften. Sie hat Handlungsfelder benannt, aber das muss jetzt umgesetzt werden. Ankündigungen von Veränderungen, ohne dass sie kommen, führen zu Verunsicherung und zu Attentismus bei den Unternehmen. Das können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen schnell Klarheit, wohin die Reise geht.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hatte gerade die Ergebnisse des im Koalitionsvertrag angekündigten Energiewendemonitorings vorgelegt. Ihre Interpretation, dass Deutschland mittelfristig viel weniger Strom als bisher erwartet benötige, weniger Erneuerbaren-Strom, hat bei Grünstromunternehmen viel Kritik bewirkt. Sie nennen ihre Aussagen realistisch. Deutschland solle daher auch die Verteilnetze langsamer ausbauen, um die mit der Wärmeversorgung belasteten Stadtwerke nicht noch zu überfordern. Ist das die wichtigste Folge aus dem Monitoring für Kommunen und Stadtwerke?
Ingbert Liebing: Die Stadtwerke werden ihre Verteilnetze ausbauen. Die Stadtwerke werden ihre Kapazität in den nächsten Jahren verdoppeln müssen. Mancherorts sogar verdrei- oder vervierfachen.
Aber wenn man ganz viel, ganz schnell machen will und alles gleichzeitig, dann geht es vor allem in die Preise. Abgesehen davon, dass es auch rein physische Grenzen gibt, vom Baustellenmanagement bis hin zu bestimmten Netzbaukomponenten mit Lieferengpässen. Bisher war die Planung auf der Grundlage einer Strombedarfsprognose, die bis zum Jahr 2030 von heute aus gesehen 50 Prozent Steigerung des Stromverbrauchs annahm.
Das ist nach Einschätzung der Gutachter des Monitoringberichtes absolut unrealistisch. Diese Einschätzung teilen wir.
Es geht Ihnen um Realismus versus übertriebene Erwartungen, die zu Preisverzerrungen durch hohe Nachfrage nach Infrastrukturtechnik führen würden. Und die Stadtwerke sehen sich hier vor allem bei den Verteilnetzen betroffen. Richtig?
Ingbert Liebing: Richtig. Kommunale Unternehmen betreiben etwa zwei Drittel der Verteilnetze. Sie stehen vor der gewaltigen Aufgabe sie auszubauen und werden sie auch ausbauen. Wenn ich aber einen zusätzlichen künstlichen Kostendruck auslöse, indem ich möglichst viel, möglichst schnell gleichzeitig machen will, dann ist das nicht gut.