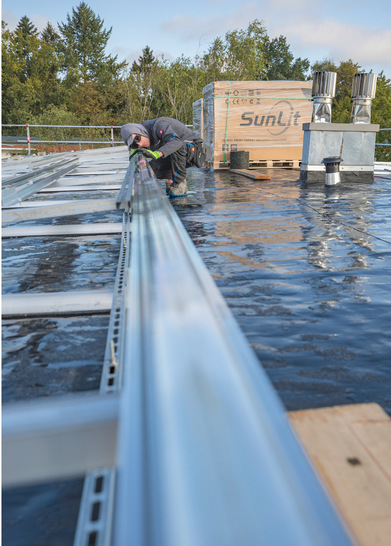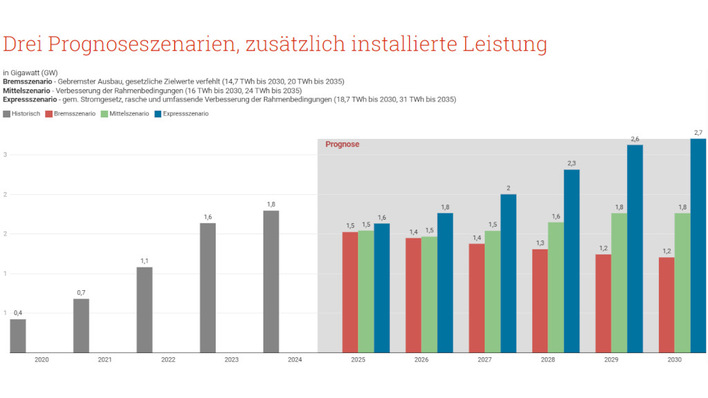Ohlsdorf ist ein grüner Stadtteil im Bezirk Hamburg-Nord, der den größten Parkfriedhof der Welt beherbergt. Mehr als 1,4 Millionen Menschen haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Drum herum befinden sich Wohnviertel, in denen etwa 17.000 Menschen leben.
Die Gebäude werden von der Firma WDM Asset Service & Immobilien verwaltet. Geschäftsführer ist Christian Warsch. Der 70-jährige promovierte Ingenieur hat 114 Wohnungen in sechs Gebäuden zum Reallabor der Energiewende gemacht. „Ich beschäftige mich seit drei Jahren intensiv mit Balkonkraftwerken“, erzählt Warsch, der bereits einen Fahrzeuganhänger zum Solarkraftwerk umgebaut hat. Zudem hat er sich zum Solarfachberater weitergebildet.
Schon länger reifte in ihm die Idee, die fünf Gebäude für Solarstrom zu nutzen. Denn: „Wir sind es unseren Kindern schuldig, dass wir die Potenziale so genialer Technologien wie der Solarenergie nutzen.“
Der Nutzung von Balkonkraftwerken standen hohe Eichen im Wege, die ein vierstöckiges Wohngebäude und den benachbarten zweistöckigen Riegel mit insgesamt 32 Wohnungen verschatten. „Die beiden Dächer mit 322 und 550 Quadratmetern sind aber nahezu ideal für Photovoltaik geeignet“, sagt Christian Warsch. „Also kam die Überlegung auf, ein Mieterstromprojekt umzusetzen.“
Mieterstrom viel zu bürokratisch
Der typisch norddeutsche Backsteinbau stammt aus dem Jahr 1968. Die Sanierung des Daches erfolgte 2023 und folgte auf die Dämmung der Giebel.
Das 100 Meter lange Gebäude ist an die Fernwärme der Stadt Hamburg angeschlossen. Ein Blick in die Gesetze verunsicherte Warsch allerdings nachdrücklich: „Mir war recht schnell klar, dass ich keinesfalls Energieversorger werden oder Dritte dafür bezahlen wollte, hochkomplexe Messkonzepte auszudenken“, erzählt er. Stattdessen reifte eine andere Idee: Warum nicht Balkonkraftwerke aufs Dach bringen und jedem Mieter eine eigene Anlage spendieren?
Mit dieser Idee im Hinterkopf kam es im Frühjahr 2024 zum ersten Telefonat mit Holger Laudeley, dem bekannten Solarteur und Pionier der Energiewende. Laudeley ist bekannt für ganzheitliche Gebäudekonzepte, die gesetzliche Regeln auf unorthodoxe Weise auslegen. Er bestärkte Warsch in der Idee, fügte nur ein kleines, aber wichtiges Detail hinzu: die Speicherung des Sonnenstroms.
Eine zündende Idee
Einen geeigneten Titel für das Konzept fanden Warsch und Laudeley schnell: solidarische Balkonkraftwerke. Es sieht vor, dass jede der 32 Wohneinheiten eine kleine Solaranlage mit jeweils vier 440-Watt-Modulen erhält. Jede Kleinanlage ist mit jeweils einem Stromspeicher im Keller verbunden. Hierfür sind die Räume unter den Kellertreppen besonders gut geeignet. Denn dort befinden sich die digitalen Stromzähler, die mit den Wohnungen verbunden sind.
Als Anbieter wurde Sunlit Solar ausgewählt, das mit dem Technologiekonzern Deye verbunden ist. Denn der Speicher Sunlit BK215 bietet einige Vorteile: Er ist modular erweiterbar und mit smartem Energiemanagement ausgestattet. „Jede Wohnung erhält einen Kopfspeicher mit 2,15 Kilowattstunden sowie einen Erweiterungsspeicher, der die gleiche Kapazität aufweist“, erläutert Holger Laudeley. Im Keller wird dieser Speicher mit einem Mikrowechselrichter von Deye verbunden. Er speist den Sonnenstrom entweder in die Wohnung oder als Überschuss ins Netz ein.
Minimale Eingriffe ins Gebäude
Die Vorteile: Die erforderlichen Eingriffe ins Gebäude sind minimal. Lediglich die digitalen Wohnungszähler wurden durch Zweirichtungszähler ersetzt. Das System benötigt keine Umbauten im Schaltschrank mit dem Hauptzähler oder am Trafo unweit des Gebäudes. Auch das Messkonzept ist simpel: Der Stromverbrauch jenseits des Wohnungszählers wird durch das smarte Energiemanagement der Batteriespeicher in Verbindung mit Shelly-Aufsätzen erfasst.
Die Kosten für die Solarmodule auf dem Dach und die Speicher trägt Christian Warsch als Vermieter. Er spricht von Solidarität zwischen Vermieter und Mieter. Denn die Lieferung von Strom ist nicht sein Hauptgeschäft, damit muss er keinen Gewinn machen. Die Mieter profitieren – ohne eigene Investitionen – von geringeren Stromkosten von etwa vier Euro pro Quadratmeter und Jahr.
Anlagen für Hausstrom oder Netzeinspeisung
Das ist deutlich mehr als bei typischen Mieterstromprojekten. Dort werden meist Strompreise erzielt, die zehn Prozent günstiger als der Grundversorger sind. „Die Hälfte dieser Einsparungen erhalte ich als Vermieter, damit sich meine Investitionen amortisieren“, rechnet Warsch vor. Für die beim Netzbetreiber (Energienetze Hamburg) angemeldeten Solaranlagen erhalten die Mieter außerdem eine Einspeisevergütung. Denn für die Mietdauer der Wohnungen gelten sie als Betreiber der jeweiligen Anlage.
Neben 128 Solarmodulen für die 32 Dachkraftwerke lässt Warsch zwei weitere Solaranlagen auf den großen Dächern installieren. Eine Allgemeinstromanlage (54 Solarmodule à 440 Watt) ist mit einem Stromspeicher mit 16 Kilowattstunden und 15 Kilowatt Leistung verbunden.
Der Speicher stammt gleichfalls von Sunlit. Er deckt beispielsweise den Strombedarf für Beleuchtung, die Umwälzpumpen für die Heizung und gemeinschaftlich genutzte Waschmaschinen. Ein zusätzlicher Wechselrichter mit zehn Kilowatt ergänzt die Anlage.
Die dritte Anlage zur maximalen Ausnutzung der Dachfläche mit ebenfalls 54 Solarmodulen ist als Volleinspeiseanlage konzipiert. Die EEG-Vergütung trägt über die Projektlaufzeit zur Amortisation der solidarischen Balkonkraftwerke bei. Mit drei verschiedenen Anlagentypen auf den Dächern nutzen Warsch und Laudeley eine gesetzliche Möglichkeit, die es seit etwa einem Jahr gibt.
Damit überspringt der Eigentümer bürokratische Hürden: Er wird nicht zum Energieversorger, wie es beim Mieterstrom der Fall wäre. Stattdessen werden die Mieter zu Anlagenbetreibern. Sie behalten ihren bestehenden Stromvertrag für die Reststromlieferung.
Alle Mietparteien zogen mit
Besonders spannend: Alle 32 Mietparteien zogen mit, Alleinstehende ebenso wie Familien. „Ich habe die Mieter umfassend informiert und mitgenommen“, berichtet Warsch. So wurden alle Mietparteien im Zuge des Projektes zu Anlagenbetreibern – und das ganz ohne „Wildwuchs“ an den Balkonen.
Das Konzept der solidarischen Balkonkraftwerke auf dem Dach hat durchaus Potenzial, mehr Mieterinnen und Mieter für die solare Energiewende zu begeistern. Je mehr die Preise für Solarspeicher sinken, umso wirtschaftlicher wird das Modell. „Ich bin sehr gespannt, wie wir in einem oder in zehn und 20 Jahren zurückblicken“, resümiert Christian Warsch. „Wird es dann viele Nachahmer für unsere Idee geben?“
Bereits jetzt häufen sich Anfragen, zum Beispiel vom Hamburger Mieterverein, der bei der Ausarbeitung der Pachtverträge half. Und immer mehr Nachbarn aus den umliegenden Gebäuden wollen wissen, wann denn endlich ihre Häuser (114 Wohneinheiten) die solidarischen Balkonkraftwerke erhalten.
WDM/LAUDELEY BETRIEBSTECHNIK
Das Ohlsdorfer Konzept im Überblick
Das Konzept „solidarische Balkonkraftwerke“ – von Christian Warsch und Holger Laudeley ausdrücklich zur Übernahme andernorts empfohlen – kommt mit geringen Umbauten am Gebäude aus. Drei verschiedene Anlagen wurden installiert:
Komponenten der Balkonkraftwerke
Komponenten der Allgemeinstromanlage:
Komponenten der Volleinspeiseanlage:
Nähere Informationen und eine Kontaktmöglichkeit finden Sie hier: